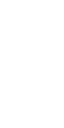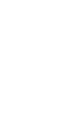„Wilde Gegend, wilde Gegend!“ – Türkei 2008
Inhalt
Es geht los: Von Thessaloniki bis İznik
Hattuša oder: Ein frostiger Empfang bei den Hethitern
Eine Landschaft wie im Traum: Kappadokien
Trauerfeier auf Türkisch
Anarvarza, 3-3-3 und erste Christen
Nemrut Dağı: Wo es auch nix zu sehen gibt
Mit Charon über den Styx oder: Wie ich mein Motorrad fast im Euphrat versenkte
Von Ölscheichs, Aramäern und Arabesken: Kurdistan und Midyat
Züchtige Blicke – von Rendel
Versenkte Minarette und durchgeknallte Ornithologen: Hasankeyf und Van-See
Wo Noahs Arche strandete: Ararat und Doğubayazıt
Durch Zentralanatolien: Heitere Konservative
Eine schöner als die andere: Amasya und Safranbolu
Türkenbiker und Wildschweinsteak: Zeytinbağı und die Ägäisinsel Gökceada
Wo die Wiege des Aristoteles stand: Olimbiada/Stagira (Chalkidiki)
Wieder daheim – Ausblick
Nachbemerkung
Es geht los: Von Thessaloniki bis İznik
„Wilde Gegend, wilde Gegend! Sie werden Noah sehen.“ – Dr. A., türkischer Kinderarzt einer befreundeten Familie, ist ganz aus dem Häuschen, als er von unseren Plänen für die 2008er-Türkeitour hört. Sein Hinweis auf delice bal, „verrückten Honig“, eine giftige, je nach Zusammensetzung psychedelisch wirkende Honigart, die von einer im Pontischen Gebirge vorkommenden Azalee gesammelt wird, verstärkt meine Erwartung und Vorfreude nur. Kurz nach der Heimkehr im Juni 2007 stand fest, dass wir viel zu viel nicht haben sehen können, um nicht wieder in die Türkei fahren zu müssen. Und nachdem Rendel ihren dreifachen Rippenbruch physisch wie psychisch gut weggesteckt hat, geht es um den Jahreswechsel an die Vorbereitung der Motorräder und die Feinplanung. Das Jahres-Urlaubskontingent wird eh dabei draufgehen, trotzdem wollen wir die Anreise so zeitrationell wie möglich arrangieren. Wir finden eine Spedition, die uns zusagen kann, die Motorräder zum gewünschten Zeitpunkt in Thessaloniki bereitzuhalten, wir selbst wollen mit dem Flieger hinterher.
So bringen wir die Motorräder eine Woche vor dem Flug zur Spedition und verabschieden uns von ihnen. Am Donnerstag, 8. Mai, fliegen wir, nur mit Handgepäck ausgestattet, hinterher. Nach einer Nacht im Hotel sitzen wir schon 24 Stunden nach unserer Abreise in Deutschland in den Sätteln, die griechisch-türkische Grenze im Visier. Schon bald strecken sich die drei Finger der Chalkidiki rechter Hand ins blaue Meer. Da wir, einer bewährten Regel folgend, bei Regen nicht fahren wollen, haben wir auch alle Regenkleidung zu Hause gelassen. Nach einem Imbiss in Xanthi zieht sich der Himmel zu, erste Tropfen fallen. „Okay, so lange die Straße noch halbwegs trocken ist …“ Dann muss ein Buswartehäuschen doch erstmal als Regenschutz dienen. Bis Komotini sollten wir noch kommen. Dort finden wir das angepeilte Hotel nicht, also bis Alexandroupoli. Rendel hat schon alles mit dem Hotel gecheckt, als sich die Wolken wieder etwas lichten. Keşan, 50 Kilometer weit auf türkischem Boden, müsste zu schaffen sein. Die Grenzabfertigung umfasst drei Stationen (Passkontrolle, Zoll, Polizei), geht aber recht zügig. Mit dem letzten Tageslicht treffen wir in Keşan ein (von der Stadt kannte ich bislang nur den Burger King …) Die Straßen sind mit Schlamm überspült, unsere Moppeds sehen schon nach einem Tag aus wie S… Das Hotelzimmer liegt im vierten Stock und stinkt, was dem Umstand geschuldet ist, dass manche Hotels die berüchtigten Klosteine auch in die Waschbeckenabflüsse legen. Wir drapieren die nasse Kleidung auf alle verfügbaren Pfosten und Haken und begeben uns auf die Suche nach etwas Ess- und Trinkbarem. Für eine Hardcore-Abstinenzlerin wie Rendel kein Problem, für mich scheint es kein Lokal mit Bierausschank zu geben. In einem Pide Salonu werden wir aber zunächst mal satt, Bier bekomme ich dann doch noch in einem Market, dessen Inhaber in Krefeld gearbeitet hatte.
Am nächsten Morgen sind die Straßen abgetrocknet, wir orientieren uns Richtung Dardanellen, setzen schon auf der Strecke Gelibolu–Lapseki über und nicht auf der bekannteren von Eceabat nach Çanakkale. Damit sind wir „richtig“ in der Türkei! An diesem Tag wollen wir an der Marmaraküste entlang über Bursa nach İznik. Die ersten 50 Kilometer ziehen sich durch grüne Wälder und Wiesen, dann wird es etwas öder. Zur Mittagsrast zweigen wir auf die markante Halbinsel Erdek ab, die sich ins Marmarameer streckt. Die Anfahrt zum gleichnamigen Ferienort gleicht die Ödnis der letzten Stunden etwas aus. Ich esse den ersten İskender-Kebap dieses Urlaubs (İskender Kebap, auch Bursa Kebap genannt, ist eine Variante der Döner Kebap, bei der das Grillfleisch mit Tomatensauce, klein geschnittenem Fladenbrot, Yoghurt und zerlassener Butter serviert wird.) Hier in Erdek fällt uns zum ersten Mal auf, wie wenig nicht-türkischen Urlaubern man außerhalb der bekannten Touri-Hotspots begegnet, östlich von Ankara konnten wir die – buchstäblich – an zwei Händen abzählen. Am frühen Abend erreichen wir den İznik-See, an dessen südlichem Ufer wir auf die Stadt gleichen Namens zuhalten. Seeufer in der Abendsonne – hier kommt zum ersten Mal echtes Urlaubsfeeling auf. Während ich fast ins Träumen gerate, passiert es: Der Angriff der Killerstörche! Schon die ganze Zeit sahen wir viele dieser großen Vögel am Ufer des Sees waten. Auf einmal halten drei Adebare frontal und in Kopfhöhe auf mich zu, ziehen erst im letzten Moment hoch. Kennt noch jemand die Frogs aus „Raumpatrouille Orion“, die immer in Schwärmen angriffen? – Ey, Alder, ich schwör: Genau so war’s!
Auch das ins Auge gefasste Hotel liegt direkt am See. Da wir am nächsten Morgen schon zeitig weiter wollen, schauen wir uns den Ort noch am Abend etwas genauer an. İznik ist das antike Nicäa, dem, der im Reli-Unterricht aufgepasst hat, vielleicht noch als Tagungsort des ersten Ökumenischen Konzils geläufig (von Kaiser Konstantin im Jahr 325 einberufen, Stichwort: Arianismus). Das Licht reicht gerade noch, dass wir uns die Reste der ältesten Kirche von İznik, in der ein späteres Konzil im 4. Jahrhundert getagt hatte, anschauen können. İznik war zudem für seine Fayence-Kacheln bekannt, die noch heute großflächig etwa in der Hagia Sophia (in İstanbul) und dem Felsendom (in Jerusalem) bewundert werden können. Hunger haben wir nicht so recht, darum gibt’s – ganz wie zu Hause – auf dem Balkon noch Chips und Bier. An Schlaf ist an diesem Abend zunächst nicht zu denken, denn Galatasaray ist gerade türkischer Fußballmeister geworden, der Autokorso unter dem Fenster lässt ahnen, warum die größte türkische Sportzeitung „Fanatik“ heißt …
Hattuša oder: Ein frostiger Empfang bei den Hethitern
Und die Bibel hat doch recht – so muss man wohl im Blick auf unser nächstes Ziel sagen. Es soll über Ankara nach Hattuša gehen, der Hauptstadt des sagenhaften Hethiterreiches. Bis ins 19. Jahrhundert war dieses Riesenreich nur durch einige Hinweise im Alten Testament „bekannt“, erst dann kamen britische Archäologen auf die Spur dieses Königreichs, das in seiner Blütezeit im 13. Jahrhundert v. Chr. (also in der Spätbronzezeit) etwa die Fläche der gesamten heutigen Türkei umfasste. Für uns heißt das, das heutige Dorf Boğazköy anzusteuern, das im zentralanatolischen Hochland direkt an die Ausgrabungsstätte von Hattuša grenzt. In dem kleinen Bergort Göynük kaufen wir eine Tüte voll Gemüse sowie Brot und Käse. Prompt spricht uns ein älterer Herr auf deutsch an, der uns, für den Fall, dass wir bleiben wollen, zur Nacht in sein Haus einlädt. Als wir bei einer Rast das Gekaufte verzehren wollen, gesellt sich wiederum ein Opa zu uns. Neugierig betrachten er und seine Kühe unsere Moppeds. Er hat zwar keinen rechten Hunger, doch freuen wir uns, auch mal etwas teilen zu können – was aber nur zum Teil gelingt, da er uns zu Brathühnchen in sein Dorf einlädt. Das lehnen wir dankend ab, nicht ohne ihm zu versprechen, das bei nächster Gelegenheit nachzuholen …
Dann stellt sich uns Ankara in den Weg, das wir auf einer der Autobahnen an der Peripherie umfahren wollen. Fehlanzeige! Wir verheddern uns völlig im sonntagnachmittäglichen Ausflugs- und Flanierverkehr, weil wir die Richtung nach Kirikkale nicht finden. Die gleichzeitige Auskunft von zehn Taxifahrern erleichtert die Sache auch nicht eben. Zudem ist meine Blase zum Bersten voll, nirgends ein Baum oder Strauch! Der Mitarbeiter einer Tankstelle muss das Pippi in meinen Augen gesehen haben und weist mir, ohne, dass ich fragen muss, zielsicher den Weg. Gesegnet seist du auf ewig! Zwei neugierige türkische Biker auf kleinen Crossern bieten sich an, uns aus der Stadt in die richtige Richtung zu eskortieren. Wir können nicht ganz mithalten, doch lassen sie sich hin und wieder gnädig zurückfallen, damit wir sie nicht verlieren. Hupend und winkend verabschieden wir uns schließlich. Die Strecke zieht sich wie Gummi, es wird dunkel und kalt. Als wir schließlich Richtung Çorum abbiegen und kurz stoppen, um uns wärmer anzuziehen, hält neben uns ein Auto, aus dem ein junger Mann steigt, ein türkischer Student aus Freiburg, der seine Eltern besuchen will und sich freut, hier „Landsleute“ zu treffen. Zum Glück steht schon am Ortseingang von Boğazköy ein Hinweis auf unsere Pension, durchgefroren kommen wir an. Wir sind die einzigen Gäste, kein Wunder bei den derzeit herrschenden Temperaturen. Auf der Speisekarte steht auch Suppe. Egal welche, wir gießen sie in uns hinein. Bier ist mir heute zu kalt, weshalb ich auf Wein zurückgreife.
Die Zimmer sind natürlich unbeheizt. Rendel friert so arg, dass sie wie bei Schüttelfrost zittert. Ausnahmsweise ohne Hintergedanken steige ich zu ihr ins Bett und wärme sie. Schließlich siegt die Müdigkeit über die Kälte, ausgeruht wachen wir am nächsten Morgen auf. Zum Glück wird wenigstens das Duschwasser heiß. Frühstück. Das Thermometer an meinem Mopped steht aktuell auf 7° C, die rückwirkende Temperaturaufzeichnung zeigt, dass wir in der Nacht Frost hatten. Draußen erscheint es uns, zumindest für die Körperteile, die der Sonne ausgesetzt sind, wärmer als drinnen, also frühstücken wir auf dem Vorplatz. Aber natürlich sind derartige Temperaturen auf einer Höhe von gut 1.000 Metern Mitte Mai keine Besonderheit.
Schon von der Pension aus erkennt man die Umrisse des rekonstruierten Stadttors von Hattuša. Bis zum Eingang kann man gut laufen. Dort angekommen, meldet meine Digicam „Bitte wechseln Sie die Batterien!“ Kann doch nicht, waren doch frisch! Zwar haben wir noch eine Kamera mit, doch ist diese die bessere. Ich latsche wieder zum Hotel und komme mit dem Mopped zurück, eine gute Entscheidung, denn der Komplex ist sehr weitläufig, dafür aber gut befahrbar. (Das Kameraproblem erwies sich als „chronisch“, die irregeleitete Elektronik verlangte immer wieder nach neuen Batterien.)
Die auf mehreren flachen Hügeln verteilte Stadt erschließt sich dem Laien nur zum Teil, gut zu erkennen sind jedoch noch die Grundmauern von Tempeln, Palastanlagen, Vorrats- und anderen Häusern. Imposant sind vor allem die großen Tore in der sechs Kilometer langen Stadtmauer, so etwa das Löwentor. Besonders interessant ist ein Würfel von vielleicht einem Meter Kantenlänge, der in einem Tempelbezirk steht, und der aus Diorit, einem glasartigen grünen Material, besteht, fast wie Jade. Das Mystisch-Monumentale erinnert an unseren Besuch in Eflatun Pınare am Beyşehir-See im letzten Jahr – auch ein hethitisches Heiligtum.
Ein junges türkisches Paar schaut sich das Areal an. Als wir an ihnen vorbeigehen, spricht uns die „bekopftuchte“ junge Frau mit einem gewinnenden Lächeln freundlich auf Englisch an. Nach kurzem Austausch gibt sie (!) uns die Hand und verabschiedet sich mit einem liebenswürdigen Memnum oldum! – „Sehr erfreut!“, dem wir Ben’de memnum oldum! – „Ebenfalls sehr erfreut!“ entgegnen. (Manches Klischee und Vorurteil bestätigt sich sicher, manch anderes wird jedoch auch in erfrischender Weise ausgehebelt. Zum Thema „Lächeln zwischen den Geschlechtern“ wird Rendel an anderer Stelle noch etwas sagen …)
Wir sind froh, das Motorrad zur Verfügung zu haben, da die Wege doch lang sind. Es weht ein kalter Wind – wir sind an diesem Vormittag eher auf schweißtreibendes Wandern denn auf Motorradfahren eingestellt.
Nach einem Mittagessen – mein geliebtes Menemen, eine Art Rührei mit Tomaten und Peperoni – machen wir uns noch einmal auf in das ein paar Kilometer entfernte Yazılıkaya, das zu dem Komplex gehört, aber ausschließlich als Heiligtum diente. Dessen zwei Kulträume („Kammern“) liegen unter freiem Himmel, eingerahmt von bis zu zwölf Meter hohen Felsklippen. Spätestens seit dem 15. Jahrhundert v. Chr. war der Ort in Benutzung, aber wohl erst im 13. Jahrhundert v. Chr. haben hier hethitische Künstler lange Reihen von Göttern und Göttinnen in die Felsen gemeißelt. Die zipfelmützige Götterparade erinnert mich an Otto Waalkes und seine Sieben Zwerge: „He-thiter, Ho-thiter …“ Der Besuch von Hattuša ist keine Enttäuschung, der Komplex zählt zurecht zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Am Abend stellt uns der Hotelier einen Wärmestrahler aufs Zimmer, den wir gerne annehmen und die ganze Nacht anlassen.
Eine Landschaft wie im Traum: Kappadokien
Von den zipfelmützigen Hethitergöttern verabschieden wir uns und halten uns Richtung Süden, wo uns aber auch Zipfelmützen erwarten, nämlich die witzig aussehenden Türmchen und Phalli im Tuffstein Kappadokiens. Bei der Abfahrt ruft uns eine Frau noch ein freundliches Güle güle gidin! – „Fahrt mit Freude!“ hinterher. Kappadokien kam im letzten Jahr zu kurz, in der Tat könnte man hier auch einen kompletten Urlaub, durchwirkt mit Natur, Kultur und Erholung, verleben (die kappadokischen Weine nicht zu vergessen …) Die schön kühle, aber auch etwas klamme Höhlenwohnung aus dem Vorjahr noch in Erinnerung, haben wir uns diesmal ein anderes „Zuckerl“ als Unterkunft ausgekuckt, das Old Greek House in Mustafapaşa. Die im Reiseführer ausgeschriebenen Preise lassen uns zwar etwas zusammenzucken – wir werden sehen.
Sowohl die durch die Erosionskräfte gestaltete Landschaft als auch die durch Menschenhand geschaffenen Siedlungen und Häuser Kappadokiens bieten eine große Vielfalt. Mustafapaşa ist noch ganz eindeutig von der ehedem griechischen Bevölkerung und hier insbesondere von den meisterlichen Steinmetzen geprägt. Das Old Greek House ist ein großes Steinhaus, wiewohl ursprünglich griechisch, im Stil eines türkischen Konak, also eines herrschaftlichen Gästehauses oder Amtssitzes, errichtet. 1887 erbaut, ging es 1924 im Zuge des Bevölkerungsaustausches an eine türkische Familie aus Thessaloniki. Prächtige Wandmalereien, Arkaden, ein herrlicher Innenhof und eine weitgehend originale, nicht künstlich auf alt getrimmte Einrichtung geben dem Gebäude einen unverwechselbaren Charme. Wir lassen uns auf drei Tage und Nächte ein, die so schön werden, dass wir auf dem Rückweg noch erwägen sollen, hier vielleicht noch mal Quartier zu nehmen.
Dem außergewöhnlichen Ambiente entspricht auch das Publikum, wobei das Hotel jedoch alles andere als mondän ist. Vielmehr treffen sich hier Individualreisende oder auch kleine Gruppen, deren Interesse einem besseren Kennenlernen von Landschaft, Kultur und Bevölkerung gilt. Wir unterhalten uns länger mit einem kanadischen Ehepaar, das sich im Anschluss an eine Mittelmeerkreuzfahrt noch die Türkei gönnen möchte. Wir können ihnen noch ein paar Tipps geben, sie geben uns ihre E-Mail und laden uns zu sich nach Hause ein.
Mustafapaşa liegt noch im kappadokischen „Kernland“, die umgebenden Tuffsteingebilde sind jedoch nicht ganz so bizarr wie etwa in Göreme, doch auch hier findet sich eine beeindruckende Landschaft. Das Dorf als solches hat einen unwiderstehlichen Reiz. Viele Häuser wurden stilecht restauriert, manche zu recht exklusiven Herbergen umfunktioniert (oder, etwa bei einer Karawanserei, ihrem ursprünglichen Zweck wieder zugeführt), wieder andere verfallen langsam. Bei einem abendlichen Rundgang entdecken wir, dass das kleine Dorf sogar Hochschulstandort ist – und zwar nicht nur, wie man vielleicht erwarten würde, für fortgeschrittenes Koranstudium, sondern u. a. für Architektur, darstellende Kunst und vieles mehr. Als wir abends durch die Tore des altehrwürdigen Gebäudes lugen, fordern uns die Hüter des Eingangs zum Eintreten auf. Beim Betrachten der wunderschön gestalteten Räume und Innenhöfe drängt sich der Gedanke an ein „türkisches Cambridge“ auf. Gewiss ist Istanbul viel prächtiger, aber hier sind wir in einem kleinen Dorf in der anatolischen Provinz! Besonders hat es mir eine einige Meter hohe Steinsäule am Eingangsportal angetan, die drehbar gelagert ist.
Mittlerweile sind auch Petra und Sigi, unsere letztjährige nette Urlaubsbekanntschaft, in Kappadokien eingetroffen. Sie reisen mit einem weiteren Paar und sind schon fast auf dem Rückweg; waren bis auf die Höhe Nemrut Dağı (dazu später mehr) und in Şanlıurfa. Zur Koordination unserer Unterkünfte hat es nicht mehr gereicht, die vier haben sich in Göreme einquartiert. Wir müssen uns unbedingt sehen, schließlich sind wir „um sechs in Kappadokien“ zum Türkeistammtisch verabredet … Wir lassen uns noch kulinarisch verwöhnen und fallen dann ins Bett.
Am nächsten Morgen verabreden wir uns mit den vier Allgäuern. Wir wollen uns eine der unterirdischen Städte anschauen, unsere Wahl fällt auf Derinkuyu. Leider war die Absprache per SMS nicht ganz eindeutig, während wir vor dem Hotel warten, stehen die anderen schon in Derinkuyu. Also auf die Moppeds, wir nehmen eine „Abkürzung“, die sich streckenweise als veritable Endurostrecke erweist. Großes Hallo, dann steigen wir mit Jens und Maria (Sigi und Petra kennen es schon) in die Höhle. Das System reicht bis zu 85 Meter in die Tiefe, verteilt sich über 13 Etagen und konnte auf einer unterirdischen Gesamtfläche von etwa vier Quadratkilometern über längere Zeit ein Gemeinwesen von ca. 20.000 Menschen beherbergen. Dabei war Platz für Menschen, Vieh, Vorräte, Dreschplätze, Keller und selbst für Schulen. Das Ganze wurde durch ein ausgeklügeltes System mittels 52 Luftschächten mit Frischluft und durch Brunnen und Zisternen mit Wasser versorgt. Im Falle eines Falles konnten Zugänge blitzschnell mittels einer Art Mühlstein verschlossen werden – nicht zuletzt für die oftmals verfolgten Christen eine nicht zu überschätzende Einrichtung. Kappadokien weist etliche derartige unterirdische Städte auf, einige sind noch unzugänglich, andere wohl noch gar nicht entdeckt. Die Vulkane Erciyes Dağı und Hasan Dağı (Dağı, ausgesprochen „Daa“, steht im Türkischen für „Berg“) haben vor langer Zeit mit ihrer Lava die Grundlage für die bizarre Landschaft Kappadokiens gelegt. Der weiche Tuff lässt sich leicht aushöhlen und formen, ein Umstand, der allerdings auch bedingt, dass diese so pittoreske Landschaft über kurz oder lang durch die Kräfte von Wind und Wasser ihr Antlitz verlieren bzw. ändern wird. So fallen regelmäßig die „Hüte“, die so manche Tuffsäule krönen, ab.
Als wir in Derinkuyu die Motorräder anlassen – nachdem wir uns noch mit viel Pide gestärkt haben –, läuft eine rundliche türkische Dörflerin auf uns zu und schwingt sich ungefragt auf Petras Soziussitz. Schallend lachend fordert sie uns auf, loszufahren. Aber ob die weite Pumphose und das Kopftuch wirklich die geeignete Motorradkleidung darstellt?
Petra, Sigi, Jens und Maria besichtigen auf dem Rückweg kurz unser Hotel – scheinen sich doch ein wenig zu ärgern, dass sie sich nicht hier einquartiert haben …
Am Nachmittag erwandern wir noch die nähere Umgebung, schauen uns einige in den Tuff gehauene Kirchen an. Auffällig sind auch die verschiedenfarbigen, stark kontrastierenden Gesteinsschichten, die man an manchen Abbruchkanten sehen kann.
Am nächsten Tag flanieren wir durchs Dorf, ein freundlicher Ladenbesitzer lädt uns zum Tee ein. Wir besichtigen noch eine Kirche im Dorf, ausnahmsweise aus Stein gemauert, danach geht es noch zu einer weiteren – jetzt wieder Tuff! –, die noch heute regelmäßig von Griechen aus Griechenland besucht und benutzt wird. Das Miteinander von Griechen und Türken scheint sich zu entspannen, so können wir im Hotel eine Zeremonie beobachten, während der unserem Hotelier eine Auszeichnung des griechisch-türkischen Freundschaftsvereins überreicht wird.
Sigi und Petra haben uns zum Abendessen nach Göreme eingeladen. Darum müssen wir uns von der Mahlzeit im Hotel, für die wir schon eingeplant sind, wieder abmelden. Rendel will das übernehmen, während ich auf dem Bett döse. Es klopft an der Tür, es gäbe Çay. Als ich runtergehe, sehe ich Rendel im Kreis der Familie und Angestellten am großen Esstisch sitzen. Es gibt nicht nur Tee, wir müssen auch etliche Spezialitäten probieren – und das angesichts einer Einladung zum Abendessen! Die Gespräche am Tisch werden erstaunlich persönlich, vor allem, als Rendel von ihrer Tätigkeit als Familien-, Kinder- und Jugendtherapeutin berichtet. Mit meinen weit geringeren Türkischkenntnissen schau ich dann immer etwas blöd aus der Wäsche, kann dann aber mein Ass im Ärmel umso wirksamer ausspielen: Anladımsa arap olayım!, lautet meine Geheimwaffe. „Ich will schwarz werden (wörtlich: „wie ein Araber“), wenn ich dich jetzt verstanden habe!“ Nach diesem Spruch kugeln sich die Zuhörer immer vor Lachen.
Der Hotelier hat uns ein günstiges Taxi nach Göreme besorgt. Mit den Allgäuern ziehen wir in ein etwas feineres Lokal, wo wir echt lecker essen. Wir quatschen noch lange, bis wir dann wieder „unseren“ Taxifahrer anrufen. Auf dem Rückweg läuft sich der Taxameter fast wund. Hab ich’s doch geahnt! Jetzt werden wir abgezockt! Hätte ich doch den Rückfahrpreis vorher abgemacht!
Nein, ich muss Abbitte leisten. Der Fahrer hatte den Taxameter nur auf den Betrag auflaufen lassen, der Hin- und Rückfahrt ergab (auf der Hinfahrt war er aus), beide Strecken kosteten dasselbe. Dabei müssten mich unsere guten Erfahrungen doch eigentlich von unnötigem Misstrauen kuriert haben …
Wir beschließen, noch einen Tag dranzuhängen. Heute soll es in das İhlara-Tal gehen. Das sind fast 80 Kilometer Anfahrt. Der Himmel ist verhangen, trotzdem starten wir. Nach einigen Kilometern müssen wir uns schon unterstellen, doch dann hellt es auf und es bleibt trocken. „Grand Canyon der Türkei“ – mit Superlativen sind nicht zuletzt Tourismusmanager schnell bei der Hand. Im Blick auf die Schlucht als solche ist das auch eine maßlose Übertreibung, das ganze „Setting“, die Vegetation und vor allem natürlich die vielen, in die Wände der Schlucht gehauenen Kirchen lassen diesen Ort jedoch zu einer echten Besonderheit werden. Leider sind die Kirchen nicht ausgeleuchtet, manches ist nicht zu erkennen. Dabei war ich so gespannt auf die „sieben nackten Sünderinnen“ in der Yılanlı Kilise, der Schlangenkirche … Trotzdem beeindruckend, was die Blitzlichtaufnahmen (war eigentlich nicht erlaubt …) zu Hause offenbarten (nein, keine Nackten). Die Wanderung zieht sich so lang, dass wir den Rückweg per Taxi bestreiten. Taxi? Diesen Service übernehmen Dörfler mit ihren Privatwagen, in unserem Fall ein mindestens 25 Jahre altes Exemplar türkischer Provenienz.
Abends werden wir noch zu einem Folkloreabend im Hotel dazugebeten, eigentlich nicht unser Ding, aber hier soll es nicht um Bauchtanz gehen, bei dem angetrunkene Männer knapp bekleideten Damen Geldscheine in den Slip stecken, sondern um etwas Authentischeres. Der Hotelier greift zur Trommel, ein Saz-Spieler kommt dazu und ein dritter Mann tanzt und singt zur traditionellen Musik. Zum Repertoire gehört auch der Kaşık dans, der Löffeltanz, bei dem Paare von Holzlöffeln, ähnlich den spanischen Kastagnetten, mit jeweils einer Hand aneinander geschlagen werden. Die anderen Gäste und wir lassen sich nicht lange bitten und tanzen mit.
Trauerfeier auf Türkisch
Beim morgendlichen Start hat es die Reiseleiterin der amerikanischen Gruppe schwer, sich Gehör zu verschaffen, zu interessant sind wir mit unseren Motorrädern. Einer der Amis erzählt, dass er auch ein Motorrad hätte, eine Halli…, Holla… – was weiß ich?! Noch interessanter wird es, als Rendel ihr mit laufendem Motor auf dem Ständer stehendes Motorrad aus den Augen lässt, woraufhin es umfällt. Zum Glück bleiben sowohl der daneben wartende Reisebus als auch das Motorrad unbeschädigt (einen Anschiss von mir gibt’s trotzdem). Vorbei am Fuß des schon erwähnten Erciyes Dağı geht es Richtung Südosten. Yumurtalık am Ostende der Çukurova-Ebene (östlich von Adana) soll ein netter Badeort am Meer sein. Bevor es in die Çukurova abfällt, wird es durch die Berge des östlichen Taurus gehen.
Wir sind bei locker bewölktem Himmel gestartet, nach etwa der Hälfte der Strecke fahren wir jedoch auf eine dunkelgraue bis schwarze Wolkenwand zu, aus der zunehmend kräftige Blitze zucken, zudem setzt Regen ein. Jetzt müsste doch eigentlich ein Dorf kommen! Bei Gewitter auf dem Motorrad werde ich immer etwas panisch. Manchmal freut man sich auch als Christ, wenn ein Minarett auftaucht, in diesem Fall das von Doğanbeyli. Wir parken die Moppeds vor einem kleinen Laden, haben natürlich gleich die Aufmerksamkeit des ganzen Dorfes. Dass ein Tourist hier durchfährt, ist schon eine Seltenheit, dass einer hier anhält, eher unwahrscheinlich. Der Regen hält sich etwas zurück, uns werden Stühle vor dem Teehaus angeboten, ein Tee folgt dem nächsten. (Apropos: Vor dem Urlaub hatte ich 14 Kilo abgenommen. Schon erstaunlich, dass ich, trotz massiven Zuckerkonsums im Tee und viel gutem Essen, nur anderthalb wieder zugenommen habe.) Mit Türkisch und etwas Englisch erzählen wir von uns und unserer Reise. Die Einladung zum Essen schlagen wir zunächst aus, kommen, als der Regen dann doch stärker wird, jedoch darauf zurück. Wir werden zu einem größeren Haus geführt. Davor sitzen an langen Tischen anscheinend alle Kinder des Dorfes, die uns natürlich mit großen Augen ansehen und fröhlich begrüßen. Wir nehmen in einem der Räume auf dem Boden Platz. Außer Rendel alles Männer, die Frauen sitzen woanders.
Bei unserer Unterhaltung hatten wir schon erfahren, dass wohl eine Türkin aus Deutschland gestorben und hierhin in ihr Heimatdorf überführt worden war. Wir sind im Trauerhaus gelandet, der aus Deutschland mit angereiste Sohn, der die Trauerfeier ausrichtet, setzt uns auf Deutsch ins Bild. Zunächst gibt es Unmengen von Ayran und Pide, das Pendant zu unserem „Beerdigungskuchen“, dann wird es still und der Hodscha stimmt eine etwa 15-minütige Trauerlitanei an. Danach verabschiedet sich der Großteil der Gäste, wir bleiben mit einigen Verwandten und Freunden der Familie zurück. Mittels des Deutschtürken, der als Produktentwickler für Müsliriegel bei einem „großen deutschen Cerealienhersteller“ arbeitet, können wir uns gut verständigen. Trotz des traurigen Anlasses lachen wir viel, lassen uns fast das süße Töchterchen eines der Männer im Tausch gegen ein Motorrad mitgeben. Eine Oma schaut um die Ecke und tituliert Rendel liebevoll mit „Mein Lämmchen“, was dem deutschen „Mäuschen“ gleichkommt.
Diese naturverbundenen Menschen, die noch Tag für Tag mit ihren Händen für ihren Unterhalt sorgen, die können bestimmt auch noch Wind und Wolken deuten, also frag ich, wann wir wohl mit Besserung rechnen können: „Es hört bald auf!“, lautet die frohe Botschaft. „Nein“, meint ein anderer, „das regnet noch stundenlang.“ „Ja, ja“, schließt einer der Onkels, „entweder hört’s jetzt auf oder es regnet noch länger.“ …
Der Opa der Familie will uns bei dem Wetter auf keinen Fall weiterziehen lassen. Er ist mittlerweile dahintergekommen, dass wir nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind, sondern mit dem Motorrad. „Ah, das ist gut, dann haben sie es nicht so schwer. Besser wäre es aber, wenn sie mit dem Auto da wären. Sag ihnen“ – so an den Übersetzer gewandt –, „sag ihnen, dass sie auf keinen Fall weiterziehen können, es ist viel zu nass und zu kalt. Sie müssen über Nacht hierbleiben!“
Aber wir müssen – und wollen – weiter. Bei der Verabschiedung versichern uns die Anwesenden, dass wir ihnen durch unseren „Besuch“ ein bisschen Licht in die traurige Situation gebracht hätten, eine Aussage, die wir, nebst der gewährten Gastfreundschaft, nur beschämt zur Kenntnis nehmen können. (Wer in Deutschland würde schon ein paar zufällig des Wegs kommende ausländische Touristen zur Trauerfeier für seine Mutter bitten?)
Anarvarza, 3-3-3 und erste Christen
Die Strecke nach Yumurtalık führt zunächst über Kozan. Bis dahin soll die Straße zwar gut sein, sich aber endlos ziehen. Kozan hatte ich nicht nur als Etappenziel im Kopf, in der Nähe soll sich ja die erst kürzlich entdeckte Bergfestung befinden, die als mögliches Versteck für den legendären Diadochenschatz gedient haben könnte. Die Strecke ist wirklich endlos, wenngleich traumhaft schön, selbst im Regen. Zeitweise fahren wir durch tiefe Schluchten, entlang des Göksu Nehri. Etwas nervös macht mich die leicht glimmende Überspannungsanzeige an meinem Motorrad, die auf einen sich anbahnenden Reglerdefekt hinweisen könnte, eine Africa-Twin-Krankheit. Zwar habe ich einen Ersatzregler mit, ein Reglersterben zieht aber häufig auch das Aus der Batterie und anderer Verbraucher nach sich, was ich nicht riskieren möchte. Also ein kurzer Stopp mit Kontrollmessung: buchstäblich alles im grünen Bereich, muss wohl an der Feuchtigkeit liegen.
Als das Nordufer des Kozan-Stausees vor uns auftaucht – wenn, dann müsste es hier zu der Festung gehen –, finden wir keinen Hinweis darauf. Da es wieder blitzt, streichen wir Yumurtalık und suchen uns ein Hotel in Kozan. Vielleicht kann man uns da ja einen Tipp im Blick auf die neue Ausgrabungsstelle geben. Das wohl einzige Hotel ist recht modern und groß, eher für Geschäftsleute denn für Touris. An einer kleinen Bude essen wir leckeren Hähnchen-Döner, der Inhaber hätte uns noch gern zu seiner Familie nach Hause eingeladen, doch für heute reicht uns die Gastfreundschaft. In einem Lädchen erstehen wir noch ein paar Flaschen Efes-Pils, die uns der Inhaber schön kälteisolierend in Zeitungspapier packt. Nach deren Genuss und nachdem wir unsere Kleidung zum Trocknen ausgebreitet haben, sinken wir schnell in tiefen Schlummer, begleitet von der Hoffnung, dass sich das Wetter bis morgen wieder zum Besseren gewendet hat.
An der Rezeption kann man uns am nächsten Morgen nichts zum Thema Bergfestung sagen, stattdessen lassen wir uns noch die Richtung zur schon lange bekannten Festung Anarvarza beschreiben, die fast auf dem Weg liegen müsste. Beim Bezahlen offenbart sich ein Missverständnis, Rendel hatte am Vorabend einen viel günstigeren Preis für die Übernachtung verstanden, der tatsächliche liegt jedoch völlig im üblichen Bereich.
Unsere Hoffnung hat sich erfüllt, der Himmel ist klar, entsprechend knallt der „Lorenz“ vom Himmel. Bis zum Abzweig nach Anarvarza ist es nicht weit, vielleicht 20 Minuten. Im vorgelagerten Dorf fängt uns der Wärter ab und geleitet uns auf seinem Moped zum Einstieg. Wir berappen den Obolus von YTL 2,- pro Person und lassen uns den Aufstieg beschreiben. Die Festung Anavarza liegt auf einem über 200 Meter hohen Burgberg, ein Ausläufer des Taurus, der in die Kilikische Ebene ragt. Sie hatte in der gesamten Antike eine große strategische Bedeutung, wurde gleichermaßen von Piraten, den Römern, von Byzanz und den Osmanen genutzt. Zunächst beeindruckt die Lage, aber auch die einzelnen Komponenten der Anlage sind sehenswert, etwa die Stadtmauer mit ihren vier Toren und 20 Bastionen (zum Teil erhalten), der Triumphbogen, der Aquädukt sowie die Ruinen der Apostelkirche, zudem die eigentliche Festung. Der schweißtreibende Aufstieg hat sich gelohnt. Wir reden mit dem Hirten, der sich im Schatten der Festungsmauern ausruht, während seine große Kuhherde inmitten der Ruinen weidet; dabei drückt er uns noch eine Ladung Pistazienkerne in die Hand, die, vermutlich nachgemachte, „antike“ Münze lehne ich dankend ab.
Wieder bei den Motorrädern lässt mich der klebrige Schweiß kaum in die Motorradkleidung kommen. Schnell nehmen wir Fahrt auf, um wieder etwas Kühlung zu erhaschen. Hier also ist der Schauplatz der meisten von Yaşar Kemals Romanen, hier kletterte sein anatolischer Robin Hood Ince Memed – der „dünne Memed“ – herum, wenn er sich mal wieder vor seinem Häschern verstecken musste – und laut diesem Roman wurde hier auch die apodiktische Feststellung getroffen: „Ein Mann muss scheißen können!“
Wir sind auf dem Weg nach Antakya, eines von mehreren Antiochias der Antike. Im letzten Jahr hatten wir das pisidische Antiochien besucht, das jedoch nur noch eine Ruinenstätte darstellt, jetzt soll uns eine wuselige, schon leicht arabisch geprägte Stadt erwarten, die, den verschiedenen ethnischen Einflüssen geschuldet, eine ausgezeichnete Küche haben soll – das hatte uns auch noch ein aus Antakya stammender Reiseleiter in Kappadokien versichert. Wir müssten vor allem die legendäre Süßspeise Künefe probieren und irgendwas mit Innereien, dessen Namen ich mir wohlweislich nicht gemerkt habe. Beiden Antiochias gleich ist, dass sie im Neuen Testament erwähnt werden, vom heutigen Antakya heißt es dort, dass die Nachfolger Jesu dort zum ersten Mal „Christen“ genannt wurden (Apostelgeschichte 11,26).
Auf dem Weg passieren wir noch eine weitere imposante Festung, Toprakkale, die sich gegen den Himmel abhebt, sowie das Gebiet von Issos, dessen Name jedem durch die dort geschlagene Alexanderschlacht im Jahr 333 v. Chr. bekannt ist. Zu sehen gibt es hier allerdings nichts, klar, war ja nur ein Schlachtfeld. So biegen wir in den südlichsten Zipfel der Türkei ein, der im Westen vom Meer und im Süden und Osten von Syrien begrenzt wird. Wir passieren die Städte Dörtyol und İskenderun, letztere soll im Sommer die heißeste Stadt der Türkei sein. Wiewohl es an der Küste entlanggeht, ist die Aussicht zunächst nicht berauschend, Hafenanlagen für Tankschiffe und petrochemische Anlagen beherrschen die Kulisse. Etwas entschädigt werden wir allerdings bei einem Tankstopp. Die Tankstelle hat nach hinten raus, direkt am Meer, eine Terrasse mit kleinem Restaurant.
Die Strecke ist eigentlich easy zu fahren, als wir ins Binnenland Richtung Antakya abbiegen, nimmt jedoch der Seitenwind zu, teilweise in heftigen Böen. An einer Stelle kann ich Rendel nicht mehr warnen, ich habe echt Angst, dass die Böe sie den Abhang hinunterdrücken könnte. Ging aber gut. (Überhaupt hat uns der Wind meist mehr zu schaffen gemacht als etwa die Wärme; teilweise fuhren wir zig Kilometer in Schräglage – und das auf gerader Strecke.) Unsere Erwartungen an die Wuseligkeit der Stadt werden nicht enttäuscht. Rendel hadert vor allem mit den unübersichtlichen Kreisverkehren. Wieder einmal nimmt sich ein freundlicher Autofahrer unser an und geleitet uns zum Hotel direkt an einer stark frequentierten Straße. Auch hier ziehen wir gleich viele Blicke auf uns. Wir dürfen die Motorräder auf dem Bürgersteig direkt vor dem Eingang parken. Nachteil ist, dass wir zu unserem Zimmer 70 Stufen – wir haben viel Gepäck! – erklimmen müssen. Das Zimmer hat zwar keine Klimaanlage, ist aber nach hinten raus, wo wenigstens der Straßenlärm nicht so ins Gewicht fällt. Nach dem Duschen setzen wir uns in die kleine Lounge, wo wir uns mit einem in Berlin aufgewachsenen, aber aus Antakya stammenden jungen Türken bekannt machen. Er betätigt sich von Antalya aus als Individualreiseführer, als solcher betreut er gerade einen Deutschen. Der Türke erweist sich als recht gebildet und auch politisch informiert, so bekommen wir noch einige Einblicke in die Situation vor Ort – und zudem noch ein paar Tipps, wo es gutes Essen und auch das berühmte Künefe gibt.
Wir sichten die Restaurantvorschläge und entscheiden uns für das am besten besprochene, leider ist das schon ausgebucht. Das, wo wir schließlich unterkommen, ist allerdings auch nicht gerade zweite Wahl, sondern vorzüglich. Besonders mundet das leckere Humus (ein Brei aus Kichererbsen mit Sesampaste) und eine hiesige Spezialität namens Oruk (auch Icli Köfte genannt), konisch geformte Teigmäntel auf Bulgur-Grundlage mit einer Fleischfüllung. Völlig baff sind wir, als wir für unser opulentes Menü in diesem fast luxuriösen Restaurant nur YTL 53,- inkl. Bier und einer Flasche Wein bezahlen müssen, also etwa 26 Euro! Beim Zahlen spricht uns die Inhaberin an, eine Deutsche, die hierher geheiratet hat. Sie hielt uns zunächst für Angehörige einer Delegation aus Weinheim, der deutschen Partnerstadt Antakyas.
Ich habe mir zwar meine Ohrenstopfen rausgelegt, bin aber wieder mal erstaunt, wie leise selbst größere türkische Städte nachts sein können – okay, vom unvermeidlichen Muezzin mal abgesehen. Die Nacht ist jedoch warm, Rendel schwitzt und bekommt wohl etwas Zug, worauf sich eine Erkältung mit leichtem Fieber einstellt.
Durch Antakya fließt der Ası Nehri, der in der Antike als Orontes bekannt war. Ası Nehri heißt „rebellischer Fluss“, wohl, weil er, anders als die meisten anderen Flüsse der Gegend, von Süd nach Nord fließt.
Beim arg mageren Frühstück unterhalten wir uns ein wenig mit einem italienischen Suzuki-V-Strom-Fahrer. Er war im jordanischen Aqaba und ist auf der Rücktour. Der Mann sieht aus wie 50, ist aber in Rente – und augenscheinlich noch recht rüstig. Irgendetwas mache ich verkehrt! Wir wollen ins berühmte Mosaikenmuseum, das hat aber noch zu. So beobachten wir erst eine Parade von Militär und Zivilisten anlässlich des „Feiertags der Jugend, des Sports und des Gedenkens an Atatürk“. Die Petruskirche, eine Grotte, in der sich die genannten „ersten Christen“ getroffen haben sollen, ist zwar wegen Renovierung geschlossen, vielleicht kann man ja doch etwas sehen. Den Tipp eines Passanten, den wir nach dem Weg fragen, doch den Bus zu nehmen, lehne ich kategorisch ab – das schaffen wir zu Fuß! Frage mich keiner, wie ich dazu kam! Der Weg zieht sich endlos durch etliche Handwerkerviertel, es ist heiß, mir schmerzt die Schulter, die durch die langen Fahrtstrecken schwer verspannt ist. Letztlich kommen wir doch an, dafür gibt’s nix zu sehen. Eine türkische Schulklasse aus Kahramanmaraş versucht ihre Englischkenntnisse an uns, die Mädchen sehr ernst, die Jungs albern nur herum. Zurück nehmen wir dann doch den Bus.
Nach einem Mittagsschläfchen geht es dann doch noch ins Mosaikenmuseum. Wirklich beeindruckend, die teilweise riesigen, aus Abertausenden Steinchen zusammengesetzten Bilder, manche mit mehreren Metern Kantenlänge bzw. Durchmesser. Auf Teppiche steh ich ja nicht so, aber so etwas …? Kommt aber in einer 90 m²-Eigentumswohnung vielleicht doch nicht so zur Geltung.
Rendel zieht gerne alleine durch die Orte, so auch heute. Sie hat schon eine Pastahane, so etwas wie eine Konditorei, entdeckt, die Künefe herstellt. Künefe ist eine Süßspeise, die im Wesentlichen aus durchsichtigen Fadennudeln, ungesalzenem Weißkäse, Butter und viel Zucker besteht. Rendel ist begeistert – und ich hab’s verschlafen. Auf ihrem Rundgang entdeckt sie auch die katholische Kirche, eine große Methodistenkirche („Protestan Kilise“) und eine Synagoge – allesamt in Betrieb. Interessant, dass ausgerechnet in diesem, aus unsere Sicht hinteren Winkel, die Möglichkeit zu einem – mehr oder minder passablem – Miteinander gegeben zu sein scheint. Wir bedauern, in Deutschland kein Visum für Syrien beantragt zu haben, so nah kommt man kaum wieder dran. (Viele Syrer hingegen kommen in die Gegend zum Urlaub – und, wie wir vielerorts versichert bekommen, um „den Alkohol in Strömen fließen zu lassen“.)
In Strömen fließt er bei uns nicht, aber das Restaurant, das wir zunächst am Vorabend aufsuchen wollten, hat heute einen Tisch frei – und eine recht nette Weinkarte. Auch hier, im Antakya Evi (nein, die Inhaberin heißt nicht „Evi“, so wie „Bei Rosi“, Ev ist vielmehr das türkische Wort für „Haus“), speisen wir vorzüglich, zudem ist das Ambiente sehr typisch, erinnert noch an die französische Kolonialzeit. (Das Hatay, also die Gegend um Antakya, kam erst 1939 per Referendum zur Türkei. Dessen Ausgang wird bis heute von vielen syrischen Nationalisten und anderen angefochten.) – Ein letzter Bummel durch die Gassen, dann fallen wir ins Bett. Morgen erwartet uns ein weiteres Highlight, der in den Reisebroschüren der Türkei allgegenwärtige Nemrut Dağı mit seinen kolossalen Götter- und Herrscherstatuen.
Nemrut Dağı: Wo es auch nix zu sehen gibt
Zeitig verlassen wir Antakya Richtung Nordost. Die Strecke ist zum Großteil langweilig, erst bei Kâhta, wo die ersten Ausläufer des riesigen Atatürk-Stausees in den Tälern aufblitzen, wird es schön und auch wieder grüner. Der Stausee ist Teil eines gewaltigen Programms zur wirtschaftlichen Förderung Süd- und Ostanatoliens. Dieses GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi/Südost-Anatolien-Projekt) genannte Programm lässt große Gegenden urbar werden, ist aber nicht unumstritten, so etwa bei den Anrainerstaaten, die befürchten, von der Wasserversorgung durch Euphrat und Tigris abgeschnitten zu werden. Auch die notwendig werdende Umsiedlung ganzer Dörfer und die Zerstörung bedeutender archäologischer Stätten (wie wir noch am Beispiel Hasankeyf beschreiben werden), hat Kritiker auf den Plan gerufen.
Wir wollen unser Quartier am Fuß des Nemrut aufschlagen und fahren erst bis zum Eingang des Nationalparks. Dort soll es nach Aussage des Italieners, den wir in Antakya getroffen haben, eine Pension geben. Die sagt uns allerdings nicht zu, wir fahren einige Kilometer zurück ins Dorf Karadut, wo wir in der gleichnamigen Pension ein Zimmer bekommen. Die Pension liegt vor einer grandiosen Kulisse, zudem hält sie, wenn auch versteckt, ein veritables Kontingent an Bier vor. Rendel macht ihren „Zug durch die Gemeinde“ und wird dabei von einer kurdischen Bauernfamilie hereingebeten. Nur mit Mühe kann sie sich der Einladung zum Abendessen entziehen, gerne hätte sie jedoch noch die frisch gemolkene und heiß gemachte Milch probiert, sie weiß aber, dass in der Pension das Essen auf dem Tisch steht. Dieses Argument versucht der Hausherr zu entkräften, indem er sagt: „Ja, aber für Geld!“ Rendel darf noch – die Tochter des Hauses ziert sich erst etwas – einige Fotos machen, verbunden mit dem Versprechen, Abzüge zu schicken (ein Versprechen, das wir immer und gerne einlösen). Etwas verlegen wird der Vater, als er seine Adresse aufschreiben soll, er kann nämlich nicht schreiben – ein Nachbar löst das Problem schließlich.
Wir plauschen noch ein wenig mit zwei bildhübschen Französinnen, die nach einem Volontariat in İstanbul noch die Türkei bereisen. Die eine der beiden ist Sprachtherapeutin und hat in İstanbul mit autistischen Kindern gearbeitet. Dann geht es früh ins Bett, weil um 3.30 Uhr der Wecker klingelt. Wir wollen zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel sein. (Der Nemrut hat zwei ähnlich angelegte Terrassen, von denen die eine bei Sonnenauf-, die andere beim Untergang in herrliches Licht getaucht wird. – Die Französinnen haben sich für den Sonnenuntergang entschieden, wofür ich am nächsten Morgen durchaus Verständnis aufbringen kann …)
Katzenwäsche muss reichen, wir besteigen beide mein Motorrad und ich fahre uns in der kühlen Morgendämmerung hoch. 700 Meter vom Gipfel entfernt ist ein kleines Restaurant. Dort parken wir, um die letzten Meter zu wandern bzw. zu klettern. Unsere Wasserflasche ist etwas ausgelaufen und hat fast unsere (letzte) Kamera durchtränkt. War zwar nicht Rendels Schuld, trotzdem blaffe ich sie an. Sorry, war ungerecht (und einer der ganz wenigen Misstöne auf dieser Tour). Der Aufstieg ist recht steil und anstrengend, zwar weht ein kalter Wind, doch wir schwitzen in den Motorradklamotten. Den Nemrut Dağı muss man sich als flachen Berg vorstellen, auf dessen Spitze noch ein kegelförmiger Gerölltumulus von 50 (früher 70 – die Besucher haben alles runtergetreten) Metern aufgeschichtet ist. Hauptattraktion sind die auf besagten Terrassen aufgestellten fünf neun Meter hohen, sitzenden und enthaupteten Statuen des Kommagenekönigs Antiochos I. Theos inmitten der Gottheiten Tyche, Zeus, Apollon und Herakles. Die Köpfe der Statuen sind jetzt vor den Torsos aufgereiht. Sie entstammen im Wesentlichen aus der Zeit von 109 bis 36 v. Chr.
Nach dem Schwitzen frieren wir im eisigen Morgenwind grausig. Meine Mütze ist bei dem Wasserflaschenmaleur durchnässt worden, mein schweißnasser Glatzkopf kühlt aus. Rendel kann eine Fleecejacke entbehren und bindet mir daraus einen Turban. Kurz unterhalten wir uns mit einem älteren deutschen Paar, das in Alanya wohnt. Sie fragen nach unseren Plänen, wir erzählen, dass wir u. a. zum Van-See wollen. „Ja“, entgegnet der Mann, „da gibt es ja auch nix zu sehen.“ Forthin wird diese Aussage für uns zum geflügelten Wort, wann immer wir staunend vor den Schönheiten dieses Landes stehen.
Endlich tauchen die ersten Sonnenstrahlen die Terrasse in ein rötliches Licht, die Statuen strahlen gelblich-ockerfarben. Auch nix zu sehen. Wir schauen uns noch das Löwenhoroskop an und stiefeln zur Westterrasse – im Abendlicht sicher ähnlich beeindruckend. Schließlich eisen (sic!) wir uns los und treten den Rückweg an.
Mit Charon über den Styx oder: Wie ich mein Motorrad fast im Euphrat versenkte
Nach dem Frühstück können wir schon gegen acht loskommen. Doch da gibt’s noch ein Problem. Sigi und Petra hatten uns schon gewarnt, dass die Fähre über den Euphrat-Stau außer Betrieb sei – zwar funktionsfähig, jedoch aus Versicherungsgründen u. ä. vorläufig stillgelegt. Das bedeutet für uns einen Umweg von gut 200 Kilometern. Wir erzählen unserem Pensionswirt davon, der daraufhin ein Telefonat führt. „Fahrt zum Anleger und fragt nach meine Fe-reund Zia – nach niemand anderem!“ Diesen konspirativ zugeraunten Rat im Ohr fahren wir ermutigt los. Am Eingang des Ortes, in dem der Fähranlieger liegt, läuft uns ein Mann armefuchtelnd entgegen, will uns auf die stillgelegte Fähre hinweisen. „Kollega, du kennst wohl meine Fe-reund Zia nicht!“ Der Anleger ist verlassen, die kleine Fähre und einige Fischerboote dümpeln vor sich hin. Schließlich kann ich einen Mann ausmachen. Zia? Nein, sein Vater. Und womit …? Nee, nicht dein Ernst??! Der Kahn ist etwas länger als mein Schreibtisch, wird – mit Glück – noch von der Farbe zusammengehalten. „No problem!“ Bis zum heutigen Tag bedeutete mir diese Aussage aus Türkenmund nicht geringen Trost, ab jetzt bin ich der Überzeugung, dass du dann wirklich ein Problem hast. Ob wir es versuchen sollen? Ganz sicher ist – auch meinem Fe-reund ist das klar – dass beide auf einmal nicht geht, also zwei Touren. Zias Vater schleppt zwei schwere, scharfkantige Stahlbleche an, die als Auffahrrampe dienen sollen. Dass die mir nicht die Reifen aufschlitzen! Beim Versuch, mein Mopped auf den Kahn zu hieven, rufe ich mindestens drei Mal laut „No, no, no!“ – „No problem.“ Ich male mir aus, wie ich dem türkischen Zoll erkläre, dass ich mein Motorrad im Euphrat versenkt habe. Schließlich ist mein Motorrad wirklich mit einer besseren Schnur (!) am Bug verzurrt. Mir kommt Charon, der grimmige Fährmann aus der griechischen Mythologie in den Sinn, der für einen Obolus die Toten über den Styx in den Hades überführte. Zias Vater als Reinkarnation? Pfeifen im Wald hilft mir auch nicht weiter, ich komme immer nur auf „Don’t Pay The Ferryman“.
Schließlich legen wir ab, der schalldämpferlose Diesel knallt infernalisch. Ich winke Rendel zu. War schön mit dir, behalt mich lieb … Doch dann wird mir bewusst, dass sich gerade ein Traum erfüllt. Ich quere den Euphrat! Mesopotamien. Zweistromland. Und das nicht ganz profan über eine Brücke oder mit einer Allerweltsfähre, sondern mit – Charon? Der hält unbeirrt Kurs, vorbei an einer kleinen Insel, auf der noch einsam ein Stoppschild steht, das daran erinnert, dass hier mal eine Straße verlief. Die Kulisse ist – sorry, wenn ich mich wiederhole! – atemberaubend. Das Wasser ist völlig glatt, an den Ufern erheben sich steil und schroff rötliche Felsen. Nach etwa einer halben Stunde kommen wir am anderen Ufer an. Das Entladen könnte schwieriger werden als das Beladen. Charon ruft zwei Helfer herbei – geschafft! Dann zurück, dieselbe Prozedur mit Rendel, ihrem Motorrad und dem Gepäck. Gerade abgelegt, fängt der Dieselmotor an zu stottern und gibt den Geist auf. Immer und immer wieder versucht Charon, das vorsintflutliche Aggregat mittels einer Kurbel anzuwerfen. Nichts. Zudem dringt nach und nach Wasser ins Boot, Rendel betätigt sich mit einem Eimer „schöpferisch“. Wir staken ans Ufer zurück, wo sich ein junger Mann mit frischen Kräften erbarmt und den Motor wieder ans Laufen bekommt. Das zweite Entladen ist etwas prekär, da die Helfer weg sind, selbst Charon kommt einmal kein „No problem!“ über die Lippen. Dann klappt’s aber doch – and I pay the ferryman.
Das Ganze hat mehr Nerven, Geld und Zeit gekostet, als es der Umweg getan hätte – aber es ist ein unvergessliches Erlebnis. Heute wurde aus dem Urlaub ein wenig Abenteuer. (Erst zu Hause kann ich Sigis Schilderung, die er uns beim Abendessen gab, richtig einordnen. Er erzählte irgendetwas von der Jandarma, die ihnen mit Verhaftung und Beschlagnahme der Motorräder gedroht hatte, falls sie einen illegalen Transportweg wählten … Gut, Bayern sind halt etwas hasenfüßig.) Charon erweist sich im Hauptberuf als Betreiber eines kleinen Gartenlokals am diesseitigen (sic!) – nicht im Hades – Fähranleger. Wir trinken noch ein paar Tee, rödeln auf und orientieren uns zunächst in Richtung Siverek – auf „ins wilde Kurdistan“!
Von Ölscheichs, Aramäern und Arabesken: Kurdistan und Midyat
Bei Siverek steuern wir eine etwas abgelegene Tankstelle an. Uns fiel schon auf, dass hier nicht nur die Frauen, sondern auch viele Männer Kopftücher tragen, ähnlich der Kufija. Ein derart bekopftuchter Mann mittleren Alters sitzt auf einem Diwan vor dem Kassenraum, mehrere andere drumrum. Etwas Türkisch zu sprechen kommt überall in der Türkei gut an, doch hat es hier, im Kurdenland, wo untereinander eben lieber kurdisch oder arabisch gesprochen wird, einen anderen Stellenwert. Nach dem Tanken bittet mich dieser Herr – ich nenne ihn fürderhin „Ölscheich“ – auf seinen Diwan, Rendel bekommt einen Stuhl. Wieder mal kommen wir über unsere Reise ins Gespräch, erzählen den erstaunten Zuhörern, die auch von der eingestellten Fähre wissen, von unserem Abenteuer. Der Inhaber betreibt die Tankstelle mit seinen Söhnen. Einer war länger in Deutschland und berichtet, kein Land zu kennen, in dem er so gerne gelebt hätte. Warum? Weil er nirgends so ehrliche, gradlinige und verlässliche Menschen kennengelernt habe. Ich verkneife mir eine Gegendarstellung. Wenn überhaupt, rauche ich nur hin und wieder ein paar Zigarillos, die Selbstgedrehte, die mir der Ölscheich anbietet, lehne ich aber nicht ab. Junge, Junge, das ist aber von dem starken Zeug, nicht von dem für die Gäste! Wir kommen auf die hohen Spritpreise in der Türkei zu sprechen, worauf der Ölscheich in sein Büro geht und mir freimütig eine Originalrechnung seiner Lieferfirma zeigt. Eine überschlägige Rechnung zeigt, dass auch ein kurdischer Ölscheich so manchen Liter Sprit verkaufen muss, um klarzukommen. Die Jungs nehmen gerne unsere Euros, wir sagen Hoşça kalın! – „Macht’s gut!“ und sind wieder on the road.
Die Gegend ist topfeben, karg und steinig, wiewohl überall Landwirtschaft betrieben wird. Auffällig die kleinen Steintürmchen, die wohl die Grenzen der Felder markieren, sehen aus wie kleine Männchen. Hier, nahe der syrischen Grenze, ist es nun wirklich heiß, heiß und trocken. Typisches Fortbewegungsmittel von Jugendlichen und denen, die sich kein Auto leisten können, sind kleine 125er, ähnlich den legendären HONDA Cub. Das kalte Grausen kommt mir jedoch immer wieder, wenn ich sehe, wie und wie ausgerüstet sie mit diesen Dingern, die locker 120 machen, fahren. Auf der Strecke setze ich an, so einen Wahnsinnigen zu überholen, fährt vielleicht 70 – natürlich mit T-Shirt, Stoffhose (Shorts trägt der Türke nicht, was aber auch keinen Unterschied machen würde) und Badeschlappen. In dem Jungen regt sich der Macho, er gibt Gas. Zunächst halte ich bis 100 mit, will mich aber nicht zu einem Rennen provozieren lassen. Als er dann nicht locker lässt und noch Sperenzchen macht, geh ich zum Schein auf ein Rennen ein, in dem ich mich aber schnell „geschlagen“ gebe. „Anerkennend“ nicke ich ihm zu, er zieht stolz davon.
An einer weiteren Tankstelle machen wir eine Rast, das Thermometer zeigt mittlerweile 42°C im Schatten. Wir sorgen für einiges Aufsehen, werden dann in ein Restaurant geführt. Der Inhaber fährt viel zu viel auf und knöpft uns dann auch viel zu viel ab. Zum Glück sind derartige Erfahrungen selten.
Für heute können wir uns zwischen den Städten Mardin und Midyat entscheiden. Zunächst steuern wir auf erstere zu. Mardin schmiegt sich höchst malerisch an einen Berg, überblickt so die mesopotamische Ebene. Die Geschichte der Stadt soll bis in die Zeiten kurz nach der Sintflut zurückreichen. Hier leben Aramäer, Araber, Kurden und Türken, damit Moslems und aramäische Christen sowie die der Teufelsanbetung verdächtigten jezidischen Kurden. Es wird kolportiert, dass hier – habe ich nicht überprüft – Teile von „Krieg der Sterne“ gedreht wurden. Vorstellbar wäre es.
Wir beschränken uns auf ein paar Fotos und die Konsultation des Geldautomaten und fahren weiter in Richtung Midyat. Wir möchten gerne im Gästehaus der Stadt nächtigen, das in einem palastähnlichen, mit aufwendigen Steinmetzarbeiten versehenen Sandsteinbau untergebracht ist. Als wir in der Innenstadt halten, sind wir binnen Sekunden von Menschen umringt, darunter viele Kinder. Einige bieten sich an, uns den Weg zu zeigen, wollen dafür bei uns mitfahren. Rendel traut sich das nicht, mit sanfter Gewalt müssen wir sie davon abhalten, aufzusteigen. In der Altstadt, hier muss das Konuk Evi irgendwo liegen, dasselbe Bild. Die Kinder rennen vor uns her, halten sich an den Koffern fest, zerren, ich muss etwas barscher werden, sonst reißen sie mich um. Schließlich finden wir das Gästehaus. Ich bleibe bei den Kindern und den Moppeds, Rendel geht rein. Mit den Blagen komm ich echt ins Schwitzen, überall fummeln sie dran rum, drücken auf Schalter und Knöpfe. In dem Gästehaus ist gerade ein Fernsehteam untergebracht, die Handvoll Zimmer komplett belegt. Schade, das wäre tatsächlich eine angemessene Residenz gewesen. Sie helfen uns aber noch, ein anderes Hotelzimmer zu bekommen, nach einigem Fragen finden wir es auch, diesmal im neuen Stadtteil Enez gelegen. Auch hier kommt es gleich zu einem kleinen Auflauf, diesmal zumeist Männer, von denen welche um Erlaubnis fragen, sich mit unseren Motorrädern fotografieren lassen zu dürfen …
In keiner türkischen Stadt findet man durchgängig verschleierte Frauen, doch merkt man schon, dass man hier nicht in İzmir oder Ankara ist. Rendel vermeidet es tunlichst, Männern offen in die Augen zu schauen. Nach dem zu reichlichen Mittagessen haben wir heute keinen Hunger mehr (Durst schon, aber Bier ist hier absolute Fehlanzeige). Dafür gönne ich mir noch einen Besuch beim Berber, dem Friseur, der sich über einen so exotischen Kunden sichtlich freut. Rendel ist immer noch erkältet, knapp 38° zeigt das Fieberthermometer.
Am nächsten Morgen nehmen wir den Bus in Richtung Altstadt. Ich hege die Hoffnung, dass wir vormittags etwas von den lästigen Kindern unbehelligt bleiben, weil die ja in der Schule sein müssten. Zunächst besichtigen wir das prächtige Gästehaus. Heute könnten wir ein Zimmer bekommen, für eine Nacht wollen wir aber nicht umziehen. Erstaunlich, dass der Prachtbau kein Palast, keine Karawanserei oder ein Repräsentationsbau war, sondern ein „schlichtes“ Privathaus. Mich faszinieren vor allem die endlosen, fein ausgeführten Steinmetzarbeiten – Arabesken, florale Elemente, Wasserspeier. Wir dürfen einen Blick in eins der Gästezimmer tun – ob wir vielleicht doch noch …
Vom Dach haben wir einen herrlichen Blick über die Altstadt, auffallend, dass hier eher Kirchtürme statt Minarette die Kulisse beherrschen. Wir würden gerne eine solche Kirche besichtigen, finden im Gassengewirr den Eingang nicht und irren etwas umher. Schließlich kommen wir an ein leicht offen stehendes Stahltor, an dem ein Kreuz prangt. Wir lugen hinein, der Innenhof ist verlassen. Schließlich taucht eine Frau mittleren Alters auf, die sogar Deutsch spricht. Mangels Zeit verweist sie uns an einen Mann um die 40, der uns die Kirche zeigen möchte. Ein Junge wird losgeschickt, der mit einem großen, altertümlichen Schlüssel wiederkommt. Die Kirche ist recht klein, ziemlich schlicht – anders, als von anderen orthodoxen Richtungen gewohnt. Wir stellen viele Fragen, insbesondere über die Situation der Christen in dieser Gegend. Hierbei handelt es sich vor allem um aramäische Christen, die so genannten „Süryani“. Sie sprechen noch ein Aramäisch, das dem, das Jesus und seine Jünger gesprochen haben, nahekommt. Früher stellten die Aramäer an die 90% der Bevölkerung Midyats, jetzt umfasst die Gemeinde nur noch etwa 400 Seelen. Unser Gesprächspartner İsa betreut vor allem die umliegenden Klöster wie etwa das bekannte Mar Gabriel. Er erzählt uns von den Schwierigkeiten, die Angehörige seiner Gemeinschaft haben. Wir sind erstaunt, dass sich etwa die Kurden, die ja auch keinen leichten Stand haben, im Zweifel lieber mit den türkischen Moslems solidarisieren als mit den ebenfalls häufig diskriminierten Christen. Zum Schluss zeigt uns İsa noch einige schöne Handschriften ihrer Bibeln und Gebetbücher.
In der Altstadt bietet fast jede Ecke ein Fotomotiv. Wir bummeln noch ein wenig und vergammeln dann den Nachmittag im Hotel. Abends gehen wir in ein einfaches Lokanta. Diese schlicht eingerichteten Restaurants bieten im Grunde Fast Food, jedoch der besseren Art. Reis-, Eintopf- und andere Gerichte warten in großen Töpfen vor sich hindampfend auf ihren Verzehr.
Züchtige Blicke – von Rendel
Schon öfter hatte ich in der Türkei empfunden, dass es als „unschicklich“ angesehen werden kann, wenn man als Frau einen Mann anschaut und anlächelt. Besonders extrem empfand ich dies in der sehr traditionell geprägten Stadt Midyat und Umgebung. Von den Männern dieser Stadt habe ich nur die Schuhe gesehen, weil ich meinen Blick gesenkt gehalten habe. Dabei sehe ich den Menschen so gerne in die Augen, man kann darin so viel lesen! Außerdem lächle ich andere gerne an – aber wenn dies als ein unmoralisches Angebot verstanden wird, verzichte ich lieber darauf. In der Nähe von Midyat bedankte ich mich (freundlich lächelnd) bei einem Kurden, der uns behilflich gewesen war. Kurze Zeit später drückte er sich an mich und küsste mich auf die Wange. Das war mir eine Lehre, vorsichtiger zu sein.
Allerdings kann man wohl keine pauschalen Urteile fällen. In den traditionell geprägten Städten sieht man Frauen mit Burka, aber auch sehr modern gekleidete Frauen ohne Kopftuch. Man sieht Paare Arm in Arm spazieren und auch Frauen, die zwei Meter hinter ihrem Mann hergehen. Man sieht auf der einen Seite Frauen, die den Augenkontakt mit Männern meiden, und anderswo Freunde, bei denen sich Männer und Frauen mit Wangenküssen begrüßen. In einigen Gegenden fand ich es jedenfalls schade, dass ich mit meinen gewohnten und meinerseits unverfänglich gemeinten Umgangsformen missverstanden werden kann, und habe es vorgezogen, meine Freiheit darin selbst einzuschränken.
Versenkte Minarette und durchgeknallte Ornithologen: Hasankeyf und Van-See
Hasankeyf – vor über zehn Jahren begegnete mir dieser Ortsname zum ersten Mal, als mir in Patara ein Kellner Bilder seines Heimatortes zeigte. Die Bilder und der Umstand, dass dieser Ort am Tigris liegen sollte, faszinierten mich sofort. Und diesen Ort sollten wir an diesem Morgen erreichen! Schon nach einer Stunde Fahrt tut sich eben die Perspektive auf, die mir von den Fotos in Erinnerung geblieben war: die tiefe Schlucht und die Stümpfe der antiken Tigrisbrücke, die auch als Ruinen noch faszinieren. Aber das ist nur ein Ausschnitt. Im Wesentlichen war Hasankeyf eine Felsenfestung (so auch eine mögliche Übersetzung des Namens; nach anderer Etymologie kann man es wohl auch als „Hasans Freude“ übersetzen). Die eigentliche Festung thront über dem tigrisseitigen Fels der Schlucht, drum herum finden sich Höhlenwohnungen und die Reste eines Gemeinwesens, das einmal 10.000 Menschen umfasst haben soll. Heute sind es vielleicht noch ein paar Hundert. Trotz der Hitze machen wir den Aufstieg zur Zitadelle, eine Anstrengung, welche die Mühe wert ist. Weit geht der Blick über den Tigris. Im „modernen“, also bis in heutige Zeit genutzten Teil des Dorfes, sticht vor allem das schöne Minarett ins Auge. Nach den Plänen des schon erwähnten GAP-Projekts wird das Minarett im Zuge des İlisu-Staudamms bis auf die Spitze in den Fluten des angestauten Tigris versinken. Allen Protesten zum Trotz sind jetzt wohl doch die benötigten Kreditgarantien für das Projekt bewilligt worden. Zwar steht auch Geld für die Verlagerung einiger der geschichtlich wertvollen Stätten zur Verfügung, was jedoch die Einmaligkeit dieses Ortes nicht wird erhalten können. Auch wegen dieses „Zeitdrucks“ wollten wir Hasankeyf unbedingt in diesem Jahr aufsuchen – bevor auch hier nur noch ein Stoppschild (oder die Spitze des Minaretts) aus dem Wasser ragt …
Wir tanken bei einem für diese Gegend außergewöhnlich freakig aussehenden Tankwart und halten uns Richtung Batman. Lieber hätten wir dort getankt, denn da in Batman ein Großteil der türkischen Ölraffinerien angesiedelt ist, soll der Sprit da günstig sein. Die zehn Kuruş pro Liter (etwa fünf Cent), bei einem Spritpreis von mehr als 1,70 Euro, entlasten unseren Geldbeutel dann aber auch nicht wirklich.
Heute „drubbeln“ sich unsere Highlights ein wenig, denn wir wollen noch bis zum Van-See. (Nein, „Pack die Badehose ein!“ spielt am Wann-See …) Bis wir diesen das erste Mal in der Stadt Tatvan am Westende zu Gesicht bekommen, müssen wir nochmal auf eine der berüchtigten Rennstrecken der LKW im Iranverkehr. Na ja … „Rennstrecke“ … Im Städtchen Bitlis stauen sich die LKWs auf der schmalen Durchgangsstraße, wir im Dieseldunst mittendrin, ich meine, einen Rußbelag auf der Zunge zu spüren. Schließlich löst sich die Schlange auf und dann sehen wir endlich Tatvan und das Seeufer. In Tatvan essen wir für YTL 8,- eine Riesenportion Lahmacun und Salat. Rendel, ausgewiesene Lahmacun-Expertin, hält es bis heute für die beste dieser „türkischen Pizzen“, die sie je gegessen hat. Am südwestlichen Ufer schlängeln wir uns bis auf 2.200 Meter Höhe, dann fällt es wieder ab. Bei einem Stopp treffe ich auf acht Jungens, die im See – zumeist in Unterhose – baden. Sie versichern mir, dass das Wasser sicak – also warm – sei, eine Aussage, die ich später noch widerlegen werde. Am gegenüberliegenden Seeufer grüßen der Süphan Dağı und der (zweite) Nemrut Dağı. Letzterem ist die Entstehung des Van-Sees zu danken. Bei einem Ausbruch des Vulkans wurde durch die Lava eine natürliche Staumauer aufgeworfen, hinter der sich das Wasser sammelte und die den See zu einer Größe anschwellen ließ, die etwa der siebenfachen Fläche des Bodensees entspricht. Der See hat keinen nennenswerten Abfluss, Flüsse, Bäche und die Schneeschmelze auf der einen, Verdunstung auf der anderen Seite halten den Wasserspiegel konstant. Diese spezielle Gegebenheit verursacht einen hohen Sodagehalt des Wassers, es fühlt sich leicht seifig an. In dieser „Lauge“ kann sich nur eine Fischart halten, eine Ukelei. Schmeckt übrigens, wie wir später feststellen können, gut. („Van-Nessie“, die immer mal wieder auftauchen soll, haben wir nicht zu Gesicht bekommen.) Eine weitere zoologische Besonderheit ist die nur hier vorkommende Katzenart, die zwei verschiedenfarbige Augen hat und die die einzige Art darstellt, die freiwillig ins Wasser geht und schwimmt.
Wir hätten uns gerne die Insel Akdamar mit ihrer armenischen Kirche angesehen, leider fährt die Fähre so ungünstig, dass wir uns das schenken müssen, wenn wir heute noch in das anvisierte Quartier kommen wollen. So bleibt es bei einem Foto vom Ufer aus. Schnell wollen wir die Stadt Van hinter uns lassen. Kurz vor der Ortsausfahrt sehe ich im Spiegel, dass Rendels Motorrad am Boden liegt! Déjà vu? Ich wende auf dem Fleck und fahre die 100 Meter zu ihr zurück. Ihr erhobener Daumen signalisiert, dass es nicht so schlimm sein kann. Mit Hilfe einiger Passanten heben wir ihr Mopped auf und bringen uns an einer Tankstelle in Sicherheit. Was war passiert? Rendel berichtet, dass ihr jemand von links die Vorfahrt genommen hat. Aus ihrer Sicht hat sie das Ausweichmanöver nicht richtig eingeleitet und sich verbremst. Aber augenscheinlich ist der Sturz glimpflicher verlaufen als im letzten Jahr. Zwar sind wieder Rippen betroffen (diesmal die andere Seite), aber wohl nicht so heftig. Ich bin froh, ihr eine gute Protektorenweste verpasst zu haben. Zehn Minuten Durchschnaufen und Beruhigen, dann geht es weiter. Sturzbügel und Koffer haben ein paar Kratzer, ihnen ist es aber geschuldet, dass Rendel nicht unter dem Motorrad zu liegen kam und dass auch am Motorrad selbst nichts beschädigt wurde.
Da es am Nordostufer kaum Unterkünfte zu geben scheint, haben wir uns in Dr. Kochs „Club Natura“ angemeldet. Diese Anlagen richten sich vor allem an Naturliebhaber (der Name klingt eher nach FKK-Camp), hier am Van-See in erster Linie an ornithologisch Interessierte. Wir sollen vor Muradiye links zum Dorf Çolpan abbiegen. In dem kleinen Flecken kann man uns nicht weiterhelfen, einen „Club Natura“ kennt niemand. Erst als ich den Vornamen von Frau Koch nenne – Aysel – klingelt es. Ein Kind läuft vor uns her und zeigt uns den Weg. Schließlich stehen wir vor einem windschiefen Maschendrahtgatter, das von einer bedrohlich zischenden Gänseschar bewacht wird – Eingangsportal zu unserer Ferienclubanlage? Mir dämmert, was es bedeuten könnte, was in einem Reiseführer über diesen Ort zu lesen war. Dort war die Rede vom „Geist und dem Spannenden eines echten Grenzpostens“. Aber wir sind richtig. Die Anlage besteht nur aus einer Reihe kleiner, ganz unauffälliger Bungalows, vielleicht fünf, sowie einem großen Gemeinschaftsraum, Küche etc. Dazu ganz abgeschieden und direkt am See – ein Traum für Ruhesuchende. Außer uns ist gerade eine Gruppe Hobby-Ornithologen da, die 14 Tage lang losziehen, um Vögel zu finden und zu bestimmen. Stolz berichten sie, in den zwei Wochen 196 Arten bestimmt zu haben. Diese Ornithologen – sie selbst nennen sich kurz „Ornis“ – haben einen Knall. Das sage nicht ich, sondern war eine Selbstauskunft, aber wer ein Hobby, egal welches, ernsthaft betreibt, der muss einen Knall haben – außer vielleicht Motorradfahrern.
Wenn man am Ort bleibt, kann man eigentlich nur eines tun: nichts. Und das machen wir in den nächsten drei Tagen sehr intensiv. Wir kümmern uns lediglich um die Wäsche und die Moppeds, lesen, faulenzen und – ja, wagen uns in das dann doch recht kalte Wasser, dass sich tatsächlich ein wenig wie Seifenlauge anfühlt. Einige der „Ornis“ sowie unser „Hausvater“ sind mit im Wasser. Ich fühle mich sauwohl und denke an den Atatürk-Leitspruch, den man überall in der Türkei lesen kann – irgendwas mit „glücklich“. Ich frage den jungen Mann, der mir dann auch antwortet: Ne mutlu türküm diyene – „Glücklich derjenige, der sich Türke nennen kann.“ Leider entgeht mir in dem Moment, dass ich damit ausgerechnet einen Kurden nötige, dieses Bekenntnis auszusprechen! Er scheint es mir aber nicht weiter übel zu nehmen. Abends gibt’s für alle Mann gemeinschaftlich Essen, unter anderem die erwähnte Ukelei.
Wenn man sich etwas aus dem Kühlschrank nimmt, notiert man es nur auf einer Liste, das alles zu sehr moderaten Preisen. (Wer erwägt, dort unterzukommen, sollte unbedingt vorher anfragen, da die geringe Kapazität durch Gruppen schnell ausgelastet ist. Zudem wird nur Halbpension – mit einem zusätzlichen mittäglichen Imbiss – angeboten, was auch Sinn macht, da es rundherum nichts gibt.) Einer der Ornis ist im Hauptberuf Botaniker, als Randgebiet auf Hummeln spezialisiert. Stolz berichtet er, dass er sechs seltene Exemplare hat fangen können. Betäubt liegen diese jetzt im Kühlschrank und sehen ihrer Präparation in Deutschland entgegen. Als ich mir ein Bier aus dem Kühlschrank hole, bekrabbelt sich eins der Viecher und macht sich vom Acker. Ich sag mal lieber nix …
Wo Noahs Arche strandete: Ararat und Doğubayazıt
Rendels Prellung schmerzt, sie hält es jedoch ohne Tabletten aus. Am Sonntag, 25. Mai, brechen wir dann zum östlichsten und damit geografischen Wendepunkt unserer Tour auf: der Ararat ist zum Greifen nahe. Wir fahren über Muradiye Richtung Norden. Die Militärkontrollen häufen sich und werden intensiver. Abgesehen vom „Kurdenproblem“ geht es dabei wohl vor allem um Schleuser und Schmuggler. Die Dörfer mit ihren Einfriedungen aus lose aufgeschichteten dunklen Steinen wirken wie Militärstellungen, die Gegend ist grün und das Terrain steigt an, wiewohl der Spiegel des Van-Sees auch schon auf etwa 1.700 Metern liegt. Kurz vor Doğubayazıt fahren wir nur wenige hundert Meter an der iranischen Grenze vorbei. Zwischen Rendel und mir läuft ein kleiner Wettbewerb: Wer sieht den Ararat zuerst? Dann ruft Rendel: „Da isser!“ Tatsächlich zeichnet sich der Gipfel zwischen zwei anderen Bergen ab. Ein paar Kilometer weiter, dann steht er in voller Pracht vor uns. Nicht ganz so wolkenverhangen wie auf vielen Bildern, uns gelingen ein paar schöne Fotos. Gut, Noah haben wir nicht gesehen, trotzdem ein erhebender Moment. In Doğubayazıt orientieren wir uns in Richtung Işak Paşa Sarayı. Das „Sarayı“ entspricht Mozarts „Serail“ und meint „Palast“. Im Vergleich zur Stadt Doğubayazıt muss allerdings alles wie ein Palast wirken, so schmutzig und staubig ist diese aus dem Boden gestampfte Stadt. Zum Palast sind es einige Kilometer, zuletzt in Serpentinen bergauf. Dann hebt sich dieses Kleinod, das buchstäblich aus Tausendundeinernacht zu entstammen scheint, gegen den Himmel ab, ein Stein gewordener Traum. Der Palast wurde im 17./18. Jahrhundert errichtet und vereint zahlreiche Architekturstile, die „Wohnfläche“ betrug fast 8.000 m² und umfasste fast 400 Zimmer. Wirkt der Palast als ganzer und auch en détail schon grandios, so setzt die Lage – auf einem Hügel vor hoch aufragenden Felswänden – der Sache noch das Sahnehäubchen auf.
Da Doğubayazıt sonst nichts zu bieten hat („Hier gibt’s ja auch nix zu sehen!“), richten wir unsere Motorräder nach Westen aus, wir hoffen, es heute bis Erzurum zu schaffen. Der Weg aus der Stadt zur Hauptstraße ist eine bessere Geröllstrecke. Auf einmal höre ich Rendel über Funk ausrufen: „Oh, neeein!“ Ein Blick in den Spiegel lässt mich durch den Staub einen Fahrradfahrer erahnen, der lang hinschlägt. Da Rendel in dem Moment aus meinem Blickfeld verschwunden ist, befürchte ich das Schlimmste, sehe dann aber, dass ihr Mopped noch fährt. Sie berichtet, dass das radelnde Kind ihre Spur ohne zu schauen kreuzen wollte. Rendel konnte zwar, trotz Schotter, mustergültig ausweichen, ohne das Kind zu berühren, jedoch hat es sich beim Sturz sicher die Knochen poliert. Nach einigen Metern meldet sich Rendel weinend, sie kann nicht mehr, hat einen Schock. Wir halten an. Rendel zittert wie bei Schüttelfrost. „Wenn ich daran denke, was hätte passieren können! Ich könnte nie wieder auf’s Motorrad steigen.“ Rationalisieren, der Hinweis, dass ja nicht viel passiert ist, dass sie ja keine Schuld hat – alles das hilft da wenig. Ich nehm sie in den Arm und lass sie weinen. Irgendwann geht’s wieder und wir fahren langsam weiter.
In Ağrı müssen wir tanken. Der Name „Ağrı“ bedeutet „Schmerz“ – und damit ist schon fast alles über diesen Ort gesagt. An der Tanke fragen mich zwei Jungs, wie denn Doğubayazıt gewesen sei. Ich antworte: Kötü – schlecht. „Und Ağrı?“ Just in dem Moment haben mich meine Türkischkenntnisse wohl verlassen … (Übrigens heißt der Ararat auf Türkisch Ağrı Dağı, also „Schmerzensberg“, wohingegen das Wort „Ararat“ auf eine falsche Vokalisierung des Namens Urartu, also des alten Reiches der Urartäer – mit Tušpa, heute Van, als Hauptstadt – zurückgeht.)
Durch Zentralanatolien: Heitere Konservative
Bei der Routen- und der damit verbundenen Zeitplanung sollte man sich in der Türkei von der Klassifizierung der Straßen auf der Karte nicht täuschen lassen, zumal nicht mit dem Motorrad. In der Türkei lässt es sich trefflich, insbesondere mit (Reise-) Enduros Motorrad fahren, doch muss man trotzdem im Hinterkopf haben, dass die Straßen dort nicht für Motorräder gemacht sind. Die Strecke zwischen Doğubayazıt und Erzurum ist in der Kategorie Fernstraße eingezeichnet, eine Stufe hinter Autobahn. Das sagt allerdings wenig über den tatsächlichen aktuellen Ausbau- und Erhaltungszustand. Auf besagter Strecke begegnete uns alles: autobahnähnliche Abschnitte, Landstraße, Schlaglochpiste und Schotter- und Geröllabschnitte – und dann vielleicht einen iranischen Kamikazetrucker vor oder hinter dir (oder beides). Auf etwa der Hälfte der Strecke kann mich ein Jandarma-Kontroletti beruhigen, bald würde die Straße sehr gut. Langsam nervt mich die dauernde Fragerei bei den Kontrollen: „Turist?“ „Nein“, würde ich am liebsten antworten, „ich bin Geschäftsmann und die Frau auf dem Motorrad hinter mir ist meine Sekretärin!“ – verkneif ich mir dann aber, denn die Jungs sind eigentlich immer sehr nett. Neben dem Straßenzustand macht uns noch etwas anderes zu schaffen: die Hirtenhunde. Allein auf dieser Strecke hetzen dreimal Köter von stattlicher Größe wie aus dem Nichts auf uns zu, wobei der Schreckmoment sicher immer das Gefährlichste ist. Ein Tourist, mit dem wir uns am Van-See unterhalten hatten, berichtete davon, dass ihm so ein Vieh eine Zierleiste an seinem Auto abgebissen hatte.
Vor Erzurum fahren wir kilometerweit parallel zur Palandöken-Gebirgskette, auf der noch Schnee liegt. Die Gegend zählt zu den bekanntesten Wintersportgebieten der Türkei. Es ist Sonntag, halb Erzurum scheint beim Picknick, einem türkischen Volkssport, zu sein. Schon Kilometer vor der Stadt hocken sie überall am Wegesrand familienweise zusammen, brutzeln und kochen Tee. Wieder einmal finden wir unser Hotel mithilfe eines vorweg fahrenden Autos. Danke! Das Hotel ist etwas nobler, entsprechende Karossen der Oberklasse parken davor. Wir jedoch – noblesse oblige – dürfen direkt vor dem Eingang parken.
Erzurum wurde uns als „sehr konservativ“ beschrieben, wir sind gespannt, wie sich das ausdrücken wird. Wer so prominent parken darf, der muss auch entsprechend speisen. Wir folgen einer Empfehlung und suchen das älteste und angeblich beste Haus am Platze auf. Hier kommen guter Service, ein gediegenes Ambiente und die türkische Gepflogenheit, in der Küche in die Töpfe schauen zu dürfen, zusammen. So stellen wir uns unser Menü nach optischen und olfaktorischen Kriterien zusammen, eine Auswahl, die dann auch die Geschmacksnerven überzeugen kann. Zudem hat das Restaurant eine echte Weinkarte.
Was auch immer „konservativ“ in so einem Kontext heißen soll – auf uns macht Erzurum einen recht heiteren Eindruck. Die Stadt ist voll, überall flanieren Paare und Familien, ein Gemisch aus Kopftuchträgerinnen und „modernen“ Frauen, alles erinnert etwas an ein großes Straßenfest, fliegende Händler, Stände mit gerösteten Maiskolben und Hammelfleisch.
Als ich aus dem Hotelfenster schaue, sehe ich, wie jemand neugierig mein Mopped befingert. Ohne Argwohn, nur zum Spaß rufe ich: „Nur anschauen, nicht anfassen!“ Aber anscheinend habe ich ihn doch etwas verschreckt …
Wir überlegen, wie’s weitergehen soll. Über Kappadokien Richtung Westen, also nochmal ins „Old Greek House“? So reizvoll der Gedanke ist, wir beschließen, uns morgen über Sivas nach Amasya, also mehr Richtung Nordwest und damit Richtung Schwarzmeerküste zu orientieren.
Eine schöner als die andere: Amasya und Safranbolu
„Erzurum, 17 Grad, wolkenlos – die Frisur sitzt.“ Also geht’s los. Die Strecke ist zunächst wieder schlimm, Schlaglöcher, Schotter, Geflicke und viele LKW. Irgendwann wird’s besser und wir fahren durch eine zumeist grandiose Landschaft: mal sehr grün, dann braun und zerklüftet, tiefe Täler, breite Bäche und Flüsse, teilweise liegt auf unserer Höhe (manchmal über 2.000 Meter) noch Schnee. Deshalb friere ich auch ziemlich. Ein iranischer Trucker lässt uns fröhlich winkend und hupend überholen, doch müssen wir ihn schon bald wieder passieren lassen, da Regen einsetzt. Mit 60, 70 Stundenkilometern tasten wir uns vorwärts. Zum Glück hört es schon bald wieder auf, wir fahren meist vor dem Regen her. Langsam mögen wir nicht mehr, doch ein Motivationsschub stellt sich 100 Kilometer vor Amasya ein. Hier ist die Vegetation schon so, wie man sich das im Bereich der Schwarzmeerküste vorstellt – die ganze Landschaft scheint vollständig in allen vorstellbaren Grüntönen eingefärbt zu sein. Was für ein Kontrast zum staubigen Osten! Nachdem wir jetzt schon seit vielen Tagen auf 1.600 bis 2.200 Metern Höhe fahren, zeigt der Höhenmesser jetzt nur noch um die 300 Meter.
Amasya gilt als die schönste Stadt Zentralanatoliens. Sie erstreckt sich beiderseits des nicht ganz kleinen Flusses Yeşilırmak in einem engen Bergtal. Der Fluss teilt die Stadt in den älteren und den neueren Teil, die durch fünf Brücken verbunden sind. Fotos zeigen zumeist die schönen Häuser der Altstadt, deren Erker zum Teil über den Fluss ragen. Diese stammen aus spätosmanischer Zeit und haben sicher zu Amasyas Ruf beigetragen. Unser Hotel hat auch solche Erkerzimmer, wir kommen jedoch im neueren Trakt unter – wegen der Mücken vielleicht besser. Dafür ragt direkt vor unserem Zimmerfenster der Burgberg in die Höhe. In ihn wurden einige imposante Gräber geschlagen, gekrönt wird er von einer Zitadelle. Mit 80.000 Einwohnern ist Amasya etwa so groß wie unsere Heimatstadt Lüdenscheid, als berühmtester Sohn kann Strabon, ein Historiker und Geograph aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., gelten.
Auch für Amasya haben wir eine Restaurantempfehlung. Der Laden erweist sich jedoch eher als Kellerbar mit lauter Musik. Als ich den Kellner darauf hinweise, zuckt er nur mit den Schultern. Also verziehen wir uns in unser Hotelrestaurant. Einem Missverständnis zufolge bekommen wir mehr Portionen als bestellt, wir kriegen es nicht auf.
In der Nacht schreckt Rendel hoch. Erdbeben!? Ich war vorgewarnt. Fast in Greifweite zu unserem Fenster, noch vor dem Burgberg, verläuft eine einspurige Eisenbahnstrecke, das vermeintliche Erdbeben war ein Güterzug, wobei man allerdings den Eindruck gewinnen konnte, er führe mitten durchs Zimmer.
Da die Nacht ansonsten sehr gut war, machen wir uns zeitig zum Burgberg auf, schauen uns die Felsengräber an (die uns aber nur mäßig beeindrucken können, von Lykien sind wir anderes gewohnt). Bis hoch zur Zitadelle schaffen wir es nicht, doch haben wir einen phänomenalen Ausblick über die Stadt und die Umgebung. Danach sehen wir uns ein schön restauriertes Konak – ein eher herrschaftliches Wohnhaus – an. Hier lässt sich ein wenig erahnen, wie der Alltag in spätosmanischer Zeit ausgesehen haben mag. Mich fasziniert jedoch fast noch mehr eine moderne Errungenschaft: Bevor man das Haus betritt, stellt man die Füße nacheinander in ein Gerät, das einem automatisch Überschuhe aus Kunststofffolie verpasst – zur Schonung der Holzböden. Wir tun uns noch ein wenig mehr Historie an und besuchen das ethnologische Museum. Hier haben es uns vor allem die schön mit Schnitzereien und Intarsien versehenen Türen angetan, außerdem werden in einem Extragebäude sechs Mumien gezeigt. Dass ich schon fast als naturalisierter Türke durchgehen kann, zeigt die Begebenheit, als mich ein Opa anspricht und nach dem Weg fragt.
Während ich ein wenig ausruhe, macht sich Rendel wieder auf Menschenjagd. Sie liebt es, durch die Straßen und Gassen zu laufen und mit Leuten in Kontakt zu kommen. Heute trifft sie auf vier Teenagermädchen, die zunächst auch ihr Englisch ausprobieren wollen, dann kommen sie ins Gespräch über unsere Reise und – deutsche Jungs! Auch ein alter Handwerker, der Schnitzwerk herstellt, freut sich über Rendels Besuch und lässt sich gerne bei seiner Arbeit fotografieren. Abends irren wir auf der Suche nach einem Lokal durch die Straßen. Wir sprechen ein paar Frauen an, die Spaß daran haben, uns zu dem gesuchten Lokanta zu geleiten. Der Abend klingt wieder im Hotelrestaurant aus, wo es anlässlich einer großen Geburtstagsfeier recht gute – türkische – Live-Popmusik gibt.
„Schönste Stadt Zentralanatoliens“ – das ist ja wohl nur noch durch „schönste Stadt der Türkei“ zu toppen. Und in die soll es heute gehen. Bei unserer Streckenführung haben wir uns die Route durch den İlgaz-Nationalpark ausgesucht. „Eigentlich“ nichts Besonderes, aber wieder mal eine einmalig schöne Landschaft, die mit Grün nur so klotzt. Auf der wenig befahrenen Strecke halten wir etliche Male an, um die Aussicht zu genießen. Über Kastamonu geht es dann nach Safranbolu.
Auf die Superlative bin ich schon zu sprechen gekommen. Ich weiß nicht, ob es die Kleinstadt Safranbolu z. B. wirklich mit İstanbul aufnehmen kann und muss, auf jeden Fall wird der Ort zum UNESCO-Weltkulturerbe gerechnet. Also auf nach Safranbolu („Safran im Überfluss“)! Der Name stammt von den riesigen Safranfeldern, von denen die Stadt im 19. Jahrhundert umgeben war und die zum Wohlstand beitrugen. Der Ort ist ein Freilichtmuseum für traditionelle türkische Baukunst. Vor allem türkische Intellektuelle haben sich der alten Bausubstanz angenommen und viele Häuser liebevoll wiederhergerichtet. Auf der Suche nach einer Unterkunft kommen wir ans Tor des Paşa Konak. Wir sind uns zwar sicher, dass uns das zu teuer ist, aber Rendel ist mit den Nerven am Ende, auch mich bringen die steilen Sträßchen aus großen, glatten Natursteinen ins Schwitzen. YTL 100,- für eine Nacht erscheinen uns dann doch angemessen und bezahlbar. Wir sind die einzigen Gäste, ein anderes deutsches Motorradfahrerpaar ist am Morgen abgereist.
Als wir unser Zimmer betreten, sind wir ein wenig irritiert. Wohl zehn mal zehn Meter groß, dick mit Teppichen ausgelegt, aufwändige Schnitzereien an Wänden und Decken, ein regelrechtes Palastzimmer. Das Haus wurde vor etwa 200 Jahren von einem in Ungnade gefallenen Minister („Pasha“) des Sultans erbaut. Der Unglückliche musste nach einer militärischen Niederlage gegen Napoleon seinen Hut nehmen. Diese herrschaftlichen Konaks gliedern sich üblicherweise in einen eher öffentlichen Bereich, den Selamlik, in dem z. B. Gäste empfangen wurden, und die Privatgemächer, den Haremlik, der der Familie vorbehalten war. Und wir nächtigen jetzt also in einem echten Harem! Unser Hotelier ist ein pensionierter Lehrer, seine Frau unterrichtet noch Musik an einer Hochschule. Sie erzählt uns von der Geschichte des Hauses und auch, dass sie bewusst auf Reiseagenturen verzichten, um bei der Auswahl ihrer Gäste noch ein wenig Einfluss zu behalten. Wir sind müde und fast wunschlos glücklich; nachdem uns die Dame des Hauses noch gut beköstigt und der Hausbursche eine Flasche Wein aufgemacht hat, fehlt es uns für den Moment an nichts. So klingt der Tag im lauschigen Garten aus.
Nach dem Frühstück zeigt uns der Hotelier die neueste Ausgabe des „Verzeichnisses kleiner türkischer Hotels“, das uns in einer älteren Ausgabe auch zu Hause vorliegt. Unser „Palast“ ist darin natürlich aufgeführt, wir bekommen aber auch Tipps für unsere letzte Station in der Türkei, wir wollen ja noch auf die Insel Gökceada. Wir würden gerne bei Barba Yorgo vorab anfragen, doch geht den ganzen Tag keiner ans Telefon – schade, vermutlich geschlossen. Wir sehen uns Safranbolu an, nehmen einen Imbiss, am Nachmittag schaut sich Rendel noch das kleine Museum und den Uhrturm an. Dabei darf sie sich körperlich betätigen, der Wärter lässt sie mit einer großen Kurbel die Uhr aufziehen.
Ich musste Rendel versprechen, beide Motorräder zunächst die Wackersteinstraße bis auf sichereres Terrain zu überführen. Deshalb entgeht mir die kleine Ansprache unseres Gastgebers zum Abschied, in der er wohl deutlich zu verstehen gibt, wie wohlgelitten und willkommen wir waren. Nett.
Türkenbiker und Wildschweinsteak: Zeytinbağı und die Ägäisinsel Gökceada
Selbst hier sind wir an der Tankstelle eine Attraktion. Zu dritt wird der Luftdruck kontrolliert. Leider ist die Tankstellenmannschaft etwas übermotiviert, mit dem Druckstrahler entfernen sie in kürzester Zeit alle Reisepatina, die wir uns so schwer erarbeitet hatten, von unseren Motorrädern. Wir nehmen ausnahmsweise die Autobahn Richtung İstanbul. Bei einer Rast ereilt mich ein Migräneanfall, der erste auf dieser Tour. Wir verlassen die Autobahn bei İzmit, passieren, diesmal am Nordufer, wieder den İznik-See und halten uns Richtung Yalova/Mudaniye. Leider verlieren sich die LKW nicht so schnell wie erhofft, was die Fahrerei zur Plackerei werden lässt. Doch schließlich wird die Straße enger und windet sich an der Küste entlang. Mudaniye erweist sich als etwas laut, wir atmen nochmal durch und fahren bis Zeytinbağı, dem alten Triliye. Ich habe noch eine Migräneattacke; während ich ausruhe, erkundet Rendel schon ein wenig den Ort. Der ist wider Erwarten sehr nett, eine schöne Uferpromenade mit vielen Fischlokalen. Neun von zehn Einwohnern von Zeytinbağı leben direkt oder indirekt vom Olivenanbau (Zeytin heißt „Olive“).
Fisch oder nicht? Wir haben von den oft horrenden Preisen gehört. Trotzdem suchen wir uns in der Küche etwas aus, entscheiden uns für Filet vom „Tonguefish“. (Zu Hause finde ich heraus, dass das bei uns unter „Hundszunge“ läuft, eine Plattfischart.) Das Zünglein mundet hervorragend, genau wie die Rechnung, die sich, inklusive zweier Bier, auf YTL 42,- beläuft, also gut 20,- Euro.
Der Abend ist schön, wir sitzen noch vor dem Hotel. Der putzige Nachtportier bietet uns an, den Wein selbst im Ort zu kaufen, er steuert dann Korkenzieher und Gläser bei.
Am nächsten Morgen legen wir wieder einen Frühstart hin, fast 30 Kilometer geht es zunächst durch Olivenhaine, dann über Bandırma nach Çanakkale, die bislang einzige Doppelung auf dieser Tour. In Çanakkale bleibt noch Zeit für einen Tavuk-Döner, dann geht die Fähre rüber auf die Gallipoli-Halbinsel. Auf dem Weg nach Kabatepe, dem Fährhafen nach Gökceada, passieren wir die Gedenkstätten der Gallipoli-Schlacht. Die Türkei gedenkt hier ihres Sieges über die Alliierten während des Ersten Weltkriegs, vornehmlich Truppen aus Australien und Neuseeland („ANZAC“), während die Nachfahren Letzterer noch regelmäßig zum entsprechenden Gedenktag hier eintrudeln. Wir sind schon schon gegen 14 Uhr am Fähranleger. Eingangs des Hafengeländes fallen uns einige Motorräder auf, zwei Honda Transalp, eine 650er-Suzuki-V-Strom und ein großer Roller, alle mit türkischen Kennzeichen. Die vier Fahrer kommen aus Adıyaman und wollen auch für’s Wochenende nach Gökceada. Zunächst kommen wir ein wenig „fachlich“ ins Gespräch, über die Moppeds, Bereifung, Helmfunk etc. Die vier sprechen ausschließlich Türkisch, es ist erstaunlich, wie wir uns mit unseren Kenntnissen und dazu mit Gesten selbst über solche Themen austauschen können. Leider geht die Fähre erst um 18.30 Uhr. Darum habe ich Zeit, noch mal eben nach Eceabat zurückzufahren, um Geld zu ziehen. (Im letzten Jahr mochte nämlich der einzige Geldautomat auf Bozcaada, der Nachbarinsel, meine Karte nicht.) Unsere türkisch-deutsche Motorradgang zieht sich in den Schatten eines Gartenlokals zurück. Wir kommen vor allem mit zwei der Türken näher in Kontakt. Der eine ist Installateur, der andere – ein Hodscha! Entsprechend zieht er sich zweimal zu den vorgeschriebenen Zeiten mit seinen Kumpels zurück, um die Gebete zu verrichten. Leider reichen die Sprachkenntnisse dann doch nicht aus, um über abstrakte, spirituelle Dinge zu reden. „Hodscha“ – so rufen ihn auch alle, ist ziemlich gerührt, als ich ihm eine detaillierte Straßenkarte der Türkei schenke, auf der sogar die kleinen Heimatdörfer der vier verzeichnet sind. Die Zeche im Lokal hätten wir gerne beglichen, doch ist das unmöglich. Die simple wie logische Begründung unserer neuen Motorradkumpels: „Ihr seid hier in der Türkei – und deshalb seid ihr hier unsere Gäste.“ Die Wartezeit wird noch etwas verkürzt, als drei Motorräder mit Schweizer Kennzeichen auftauchen. Die drei Fahrer um die vierzig sind auf dem Landweg von der Schweiz angereist. Sie haben drei Monate Zeit und wollen weiter bis Indien. Auch mit ihnen tauschen wir noch Tipps aus. Sie haben sich für leichtere Einzylinder entschieden: KTM LC4, BMW F650GS und eine alte Yamaha Ténéré. Sie wollen heute noch auf dem Festland campen und morgen auch nach Gökceada übersetzen.
Schließlich läuft die Fähre ein, ein schon größeres und schnelles Teil vom RoRo-Typ. Wir dürfen als Erste drauf und platzieren uns zur zügigen Ausfahrt ganz vorne an der Rampe. Nach einer Stunde fünfzehn laufen wir in Kuzulimanı, dem „Schafshafen“, ein. Gerne hätte ich ein Foto vom Pier aus gehabt, wie sich die Rampe senkt und wir sechs aus dem Schiffsrumpf preschen. Der Installateur war als Soldat auf Gökceada, kennt den Ort, in den wir wollen. Die vier fahren vor, und dann verabschieden wir uns an einer Abzweigung. Nach etwa 15 Minuten kommt der Wegweiser nach Tepeköy, „Gipfeldorf“, der Ort, in dem Barba Yorgo sein Hotel haben soll. Wir haben uns entschlossen, auf gut Glück dorthin zu fahren.
In der Dämmerung wirkt das Dorf ziemlich verlassen und verfallen, ein Eindruck, der sich auch bei Licht nicht wesentlich ändern soll. Wir halten auf den „Ortskern“ zu, wo Licht brennt. Als wir die Helme absetzen, hören wir auch Musik. Man fühlt sich in einen griechischen Ort mit Taverne versetzt. Tatsächlich ist Tepeköy immer noch (oder wieder) fast ausschließlich von Griechen bewohnt, Griechen wie etwa Barba Yorgo, „Onkel Georg“. Wir tragen unseren Zimmerwunsch vor, zwei „griechischstämmige Deutsch-Türken“ helfen uns (der eine will mir gleich ein Wasserglas voll Rakı kredenzen, was ich dankend ablehne). Eine junge Frau wird angewiesen, uns zu begleiten. Wir marschieren wieder ein ganzes Stück ortsauswärts, dort wird uns ein kleines Häuschen zugewiesen, alt, aber ein richtiges kleines Apartment mit zwei großen Zimmern. Wir holen schnell die Moppeds nach, ziehen uns um und gehen wieder zur Taverne.
Mittlerweile ist es halb zehn und wir haben Hunger. Wir lassen Essen auffahren, dazu eine Flasche selbst gekelterten Roten. Der Zaziki ist köstlich, dazu etwas Unindentifizierbares, könnten Pilze sein. Schmeckt gut. Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass es sich um Meeresfrüchte handelt, aber das kann ja nicht sein, denn die mag ich ja nicht … Da sich darin keine Tentakeln und Saugnäpfe fanden, haben wir das nicht erkannt. Ich entziehe mich noch mehrmals den Einladungen zum Rakı, dann gehen wir zum Appartement. Im Flur stehen unsere Stiefel, als Rendel sie hochnimmt, blickt sie entsetzt auf fieses Getier. „Kakerlaken!“, rufe ich und schlage auf die Viecher ein, wohl wissend, dass Kakerlaken hart und zäh sind.
Nachts kratzt und raschelt es im Zimmer. Das erweist sich jedoch als Schaf, das vor dem offenen Fenster grast. Am nächsten Morgen stelle ich fest, dass meine Kakerlaken-Diagnose voreilig war. Auf unserem Weg durch die dunkle Straße waren wir in Schafskacke getreten. Unsere Stiefel hatten dann durch die offene Tür viele Mistkäfer angezogen. In der Folge ließen wir die Schuhe draußen – und hatten Ruhe. (Auf Türkisch heißt „Kakerlake“ übrigens bezeichnenderweise Hamam böceği – „Hamam-(Badehaus-)Käfer“. Dazu noch ein Tipp, den ich mal von einem Angehörigen des israelischen Militärgeheimdienstes bekommen habe: In der Wüste im Zweifel immer dahin setzen, wo Mistkäfer sind – denn da sind keine Skorpione …)
Samstag, 1. Juni, Rendels Geburtstag. Wegen der „Kakerlaken“ fühlt sie sich erst ein wenig unwohl, was sich aber nach dem Aufräumen und Einrichten legt. Wir erkunden die Insel, fahren an einen der zahlreichen Strände. Dieser ist jedoch sehr mit Seetang verunreinigt. Ein Kite-Surfer zischt mit Affenzahn über die Wellen. Die Insel ist sehr schön und landschaftlich recht vielfältig. Als einzige Ägäisinsel hat sie keine Wasserprobleme, ein Stausee dient als großes Reservoir. In Kaleköy, dem touristischen Hauptort, machen wir Rast. Eine Kioskbesitzerin setzt uns anhand eines Übersichtsplans gut über die Sehenswürdigkeiten der Insel ins Bild. (Apropos „Kiosk“: Das Wort kommt aus dem Türkischen, abgeleitet von Köşk, einem offenen Gartenpavillon.) Dort treffen wir nochmal die drei Schweizer, denen wir noch einen Tipp zu einem Campingplatz geben können.
Ein Mittagsschläfchen verkürzt die Zeit bis zum Abendessen. Es soll Wildschwein geben! Ich bin etwas skeptisch, doch fang ich fast an zu sabbern, als ich das riesige Steak vor mir auf dem Teller sehe. Kööstlich! Zwar bin ich kein Lamm-Fan, doch mundeten auch die entsprechenden Gerichte hier – etwa Köfte vom Lamm – hervorragend. Tatsächlich sind Schafe und Ziegen hier allgegenwärtig – buchstäblich. Während des Essens laufen sie zwischen den Tischen her (abends immer dasselbe Pärchen), traben über Terrassen und Vorgärten – mit den entsprechenden Hinterlassenschaften. Dafür schweigt hier der Muezzin, morgens erklingt das Glöckchen der kleinen griechisch-orthodoxen Kirche (und der Pope wandert durchs Dorf).
Wir kommen mit dem türkischen Ehepaar, das das Nachbarappartement bewohnt, ins Gespräch. Sie sind Architekten aus Istanbul und fahren fast jedes Wochenende die 350 Kilometer, schlafen manchmal, wenn sie die Abendfähre nicht mehr bekommen haben, am Hafen im Auto, um dann morgens überzusetzen. Natürlich tragen sie sich mit dem Gedanken, hier selbst etwas zu kaufen und zu restaurieren.
Diese Nacht haben wir ungestört und gut geschlafen. Wir wollen endlich mal baden. Auf dem Weg zum Strand Gizli Liman sehen wir Ziegen mit rotem Fell. Der Strand an der Westspitze ist tatsächlich super, fast so schön wie Patara, vom Panorama her noch schöner. Im Dunst kann man die griechische Insel Limnos erkennen. Hier ist auch gleichzeitig der äußerste westliche Punkt der Türkei, wir haben die Türkei also – mal von ein paar Kilometern im Osten abgesehen – ganz von Ost nach West durchmessen (und auch nahezu von Süd nach Nord). Am Strand – grober Sand, klares Wasser – sind wir ganz alleine. Auf dem Rückweg fahren wir noch in Dereköy vorbei, „größtes Dorf der Türkei“. Es soll einmal aus 2.000 Häusern bestanden haben, ist aber heute fast ein Geisterdorf. Die Kioskbesitzerin hatte uns noch auf einen Flecken namens Marmaros aufmerksam gemacht, bei dem es einen Wasserfall geben soll. Der Abzweig liegt auf dem Weg, von der Hauptstraße sollen es etwa sieben Kilometer sein – keine Strecke. Jedoch ist der Weg nach kurzer Zeit derart, wie man sich eine schöne Endurostrecke vorstellt. Rendel kommt dabei fast an ihre Grenzen, schafft aber alles prima. Marmaros, direkt am Meer, ist wohl eine aufgegebene Militärstellung, leider liegen die Trümmer der Gebäude wild in der Gegend herum. Die Bucht hingegen ist traumhaft und – kein Wunder – menschenleer. Wenn es irgendwo einen Abzweig zum Wasserfall gibt, haben wir ihn verpasst, wir können den Wasserfall nur in der Ferne erahnen.
Im Nachbarort von Tepeköy soll es bei einer alten Dame hervorragenden Kaffee geben, scheint aber geschlossen zu sein. So holen wir uns im Insel-Hauptort İmroz ein paar Simit – Sesam-Hefekringel –, die wir an Ort und Stelle verputzen.
Wir essen früh zu Abend, weil wir den Sonnenuntergang bei einem Glas Wein an einem Picknickplatz in der Nähe unseres Dorfes erleben wollen. Weil es dunstig ist, kann man die Sonne zwar nicht verschwinden sehen, der Blick über das Meer auf die nur etwa 25 Kilometer entfernte Insel Samothrake war den Weg jedoch wert. Wir haben unseren Spaß, als ich versuche, uns beide mit Selbstauslöser zu fotografieren, wofür ich etliche Male hin und her rennen muss.
Noch schnell ein Abschiedsfoto mit Barba Yorgo, dann zahlen wir und machen uns ans Packen, denn morgen werden wir ungefrühstückt losfahren, da wir schon um 6.30 Uhr an der Fähre sein müssen. Tatsächlich können wir am nächsten Morgen als Erste auf die Fähre, wieder ganz vorne. Wir frühstücken an Bord, dann macht Rendel einen Kontrollgang zu den Moppeds, denn die See ist etwas aufgewühlt. Beim zweiten Mal muss sie berichten, dass ihr Mopped umgekippt ist. Wir laufen runter und richten es mit Hilfe eines Türken auf. Zum Glück ist keines der umstehenden Fahrzeuge beschädigt worden, der rechte Spiegel von Rendels Mopped musste allerdings dran glauben. Rendel ist durch den Gestank des ausgelaufenen Benzins, den Seegang und den Schrecken speiübel. Ich schicke sie an Deck und postiere mich zwischen beiden Motorrädern, kralle mich an ihnen fest und trotze so Wind und Wellen … Nach dem Entladen halten wir uns Richtung Keşan, dem ersten Übernachtungsort in der Türkei auf der Hinfahrt. Ich sehe den Blitzer von Weitem, meine auch, das Tempolimit eingehalten zu haben. Lange nix, dann der Kontrollposten. Strenger Blick, winkt mich etwas barsch zur Seite. Der Cop geht erst zu Rendel, ich beobachte im Spiegel. Verhackstückt irgendwas mit ihr, dann bin ich dran. Hinter dem Rücken zaubert er ein kleines Tablett hervor, auf dem ein Sortiment an „süßen Stückchen“ liegt – ich solle mir eins aussuchen. Sein Kommentar lediglich ein verschmitztes „Good bye!“ Beamtenwillkür.
Dann heißt es tatsächlich „Good bye, Türkei!“ Die Grenzabfertigung geht zügig, lediglich der griechische Zöllner will einen Blick in unsere Koffer werfen.
Wo die Wiege des Aristoteles stand: Olimbiada/Stagira (Chalkidiki)
Um noch ein wenig auszuspannen und zudem kein Risiko mehr im Blick auf unsere Rückreise einzugehen, wollen wir noch ein paar Tage in Griechenland – schon in der Nähe von Thessaloniki – verbringen. Olimbiada, eingangs des östlichen Fingers der Chalkidiki, also dem, auf dem die Mönchsrepublik Athos liegt, hört sich gut an. Im Hotel Liotopi finden wir eine schöne Bleibe. Der Ort ist um diese Zeit noch ruhig, wir sehen vom Zimmer aus auf die Bucht. Die Halbpension behagt uns erst nicht, was sich aber schnell gibt, als wir die reichhaltige Auswahl in der hoteleigenen Taverne kennenlernen. Oberhalb des Hotels, in Laufweite, erstreckt sich das antike Stagira, das seit einiger Zeit gesichert als Geburtsort des Philosophen Aristoteles gilt. Am zweiten Tag nehmen wir uns Zeit, die sehenswerten Reste Stagiras zu erkunden. Dabei entdecken wir auch eine schöne Bucht, die zum entspannten Ausklingenlassen dieses Urlaubs wie geschaffen ist. Die Inhaberin des Hotels, „Lulu“ genannt, ist eine freundliche, warmherzige Gastgeberin, die es uns an nichts mangeln lässt. Ihr zur Hand geht eine junge, extrem flotte und fleißige junge Frau aus Georgien, die, so erfahren wir erst am letzten Tag, genau wie ihre Landsmännin in der Taverne, schon in der Heimat ein Hochschulstudium absolviert hat. Wir unterhalten uns mit einem sehr netten, „feinen“ Ehepaar aus England. Mir fällt ein alter Austin Healey mit Osnabrücker Kennzeichen vor dem Hotel auf (in Osnabrück haben wir studiert). Der Besitzer erklärt mir die aufwendige Restauration des Wagens. Mit ihm und seiner Frau sitzen wir nach dem Abendessen lange zusammen. Sie wollen weiter nach Bulgarien, um an einer Hochzeit teilzunehmen. Witzigerweise heißt er auch Detlev – und auch mit „v“! Im Hotel wird’s etwas rummeliger, da eine Gruppe aus Bulgarien eingetroffen ist. Ein großer Hund bewacht unsere Motorräder, so gut, dass Rendel nachts, als sie mal an die Reiseapotheke muss, fast selbst nicht rankommt.
Abreise. Am Vortag hat es wie aus Kübeln geschüttet, auch heute ist nicht sicher, dass es trocken bleibt. Tatsächlich müssen wir auf der Fahrt nach Thessaloniki noch ein Stück durch den Regen. Leider hatte ich vergessen, auf der Hinfahrt die Position der Spedition im GPS einzugeben, so müssen wir lange suchen. Auf dem Weg buchen wir noch schnell ein Zimmer in dem Hotel, in dem wir schon die erste Nacht verbracht hatten. Die Speditionsleute sind sehr hilfsbereit, wir können uns in Ruhe umziehen und die Moppeds versandfertig machen. Ein Mitarbeiter fährt uns sogar noch zum Hotel. Abends lassen wir es uns dann noch in der urigen Taverne, in der wir auch schon am Anfang gegessen hatten, gutgehen – mal wieder viel zu viel zu viel!
Am nächsten Morgen geht es mit dem Bus zum Flughafen. Nach einem ruhigen Flug und einer Bahnfahrt kommen wir in Hagen an. Wir nehmen uns ein Taxi nach Lüdenscheid, natürlich mit türkischem Fahrer. Wir erzählen, und es ist nicht sicher, wer begeisterter ist: wir, die Erzähler, oder unser Zuhörer.
Wieder daheim – Ausblick
So, jetzt müsste es doch eigentlich mit der Türkei reichen – oder …? Tatsächlich haben wir die Türkei – zusammen mit der letztjährigen Fahrt – komplett von West nach Ost und von Nord nach Süd durchmessen, haben Hunderte Sachen gesehen, viele erinnerungswürdige Begegnungen mit Menschen gehabt – und tausend Dinge nicht gesehen, unzählige Begegnungen warten noch auf uns.
Nachdem sich die Fülle der Erlebnisse ein wenig gesetzt hat, manches durch die vielen Erzählungen wieder neu Revue passiert ist, kommt natürlich – allem vorgeblichen Widerstand zum Trotz – doch bald die Frage auf, wo es denn nächstes Jahr hingehen soll. Wir erwägen Makedonien, den Kosovo und Kroatien, Georgien und Armenien – oder doch per Flieger und mit dem Rucksack nach Syrien und Jordanien? Vorläufiges Ergebnis: Wir fahren durch die Türkei nach Syrien. Und Petra und Sigi kommen auch mit.
Nachbemerkung
Kurz nach unserer Rückkehr wurde eine Gruppe Touristen bei einer Ararat-Besteigung von PKK-Kämpfern entführt. Die Sache ging glimpflich aus, die Entführten kamen nach einigen Tagen – zumindest körperlich – unversehrt frei. Ohne ständig die Gefahr im Hinterkopf zu haben, waren und sind wir uns ihrer durchaus bewusst. Nach besagtem Vorfall erging vom Bundesaußenministerium ein Sicherheitshinweis hinsichtlich des Reisens in bestimmte östliche Provinzen der Türkei. Auch, wenn dieser Hinweis während unserer Reise noch nicht existierte, waren wir uns über die prinzipielle Gefährdung immer im Klaren. Leichtsinn? Ich denke nicht. Wir halten die Türkei immer noch für ein sehr sicheres Reiseland, zumal andere Gefahren, die in anderen Urlaubsländern zum Teil gang und gäbe sind (Kapitaldelikte, Raub u. ä.), in der Türkei sehr selten vorkommen. Trotzdem würden wir nicht einfach unüberlegt wieder in jedwede Gegend fahren, wo man mit überdurchschnittlicher Gefährdung rechnen muss. So war etwa kurz vor meiner 1999er-Türkei-Motorradreise gerade PKK-Chef Öcalan verhaftet worden, ein Umstand, der mich dann schon überlegen ließ, ob die Reise angeraten sei (was ich dann bejahte, da ich mich auf den westlichen Teil der Türkei beschränken wollte). Also – Leichtsinn nein! Kalkuliertes Risiko – ja!
Stand: September 2008